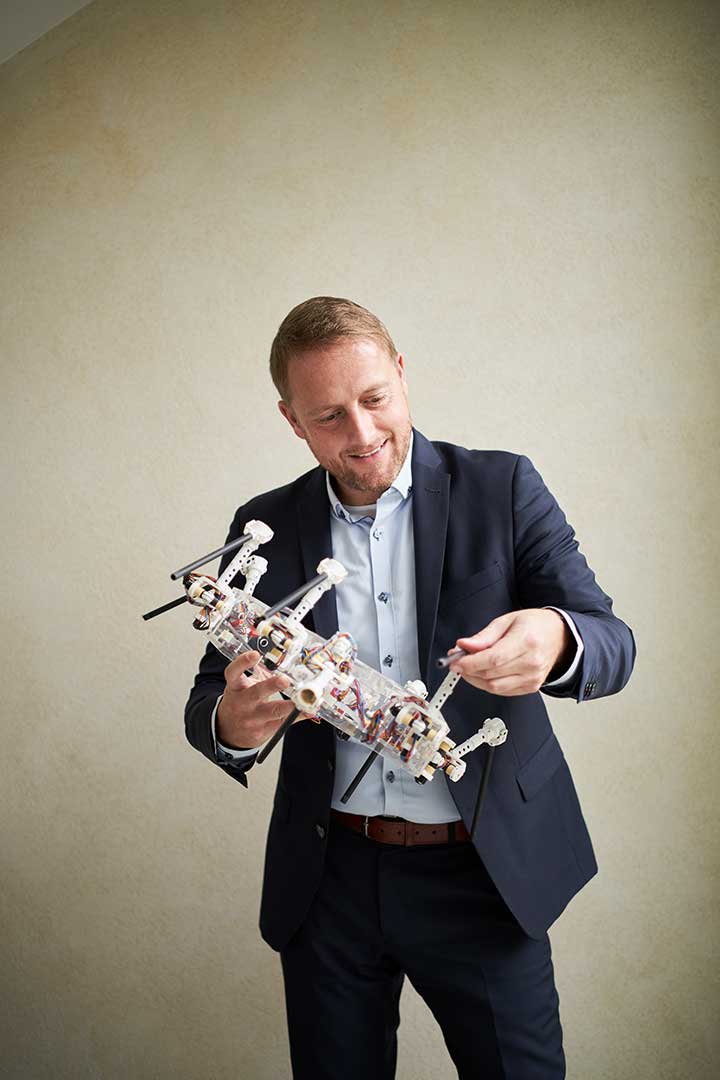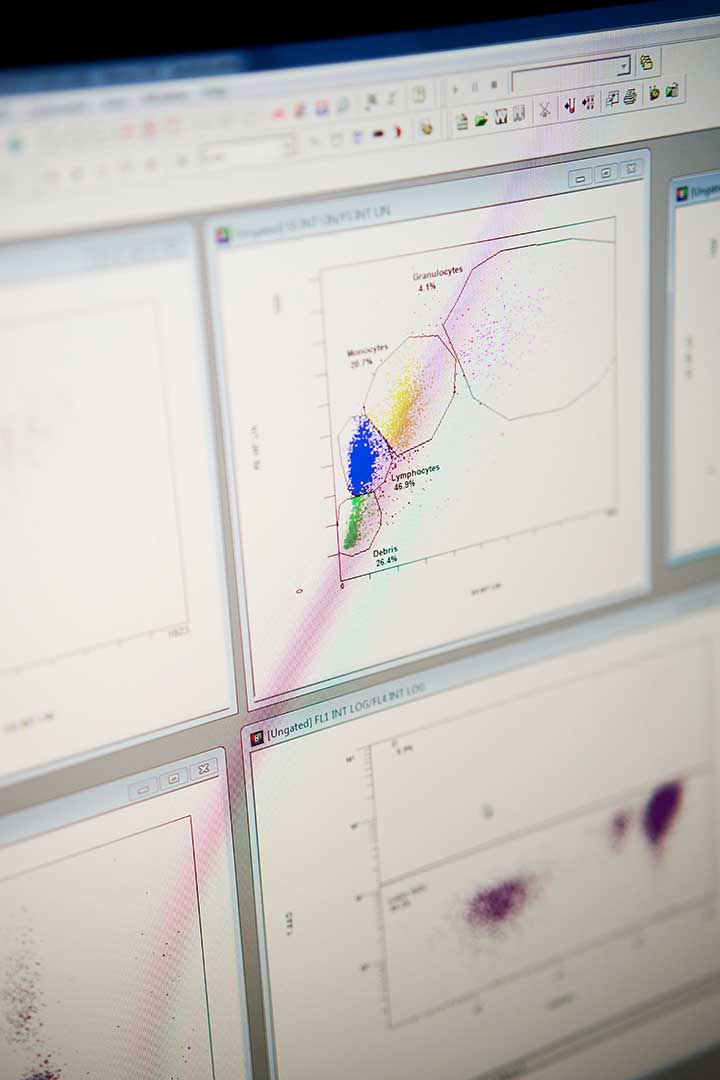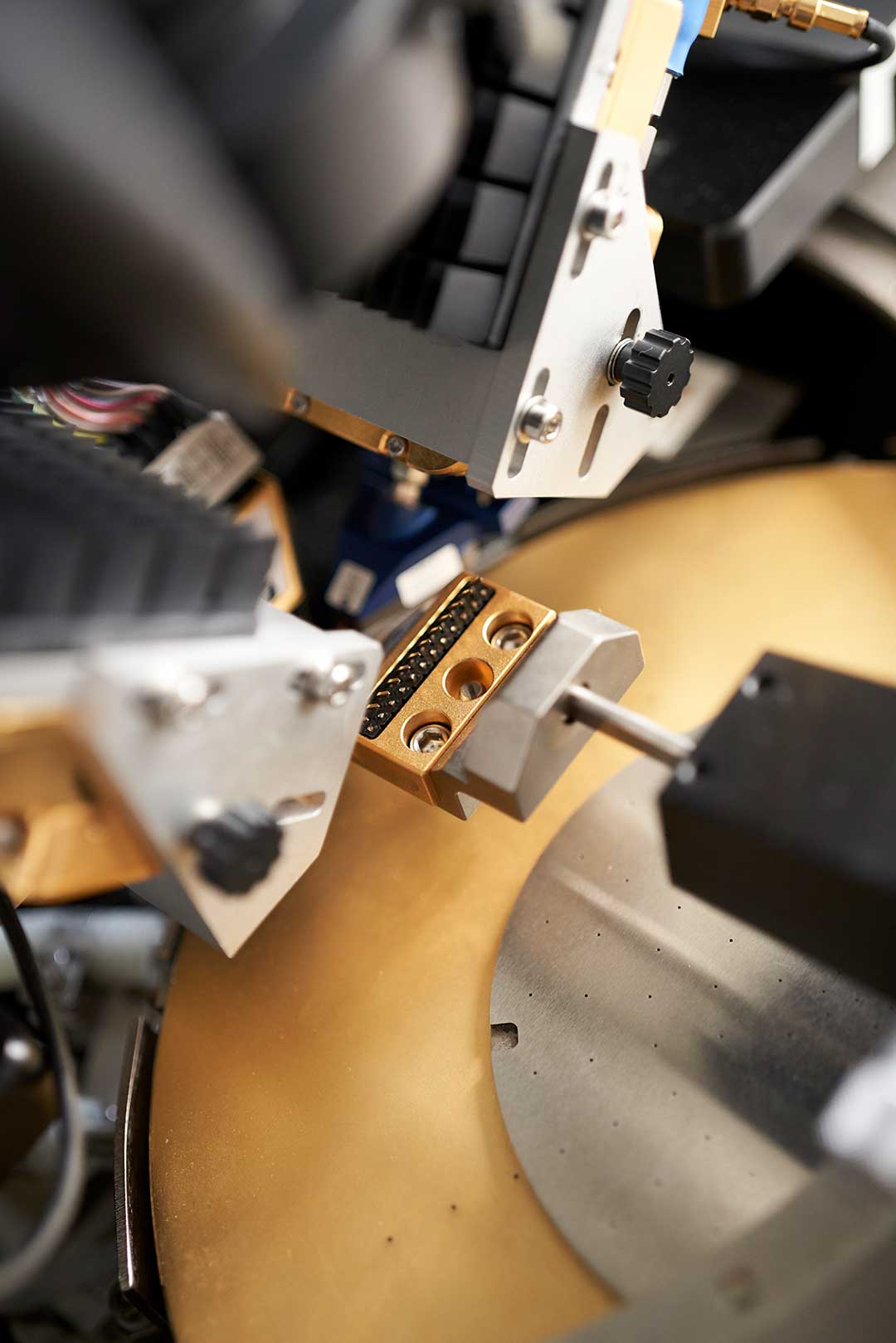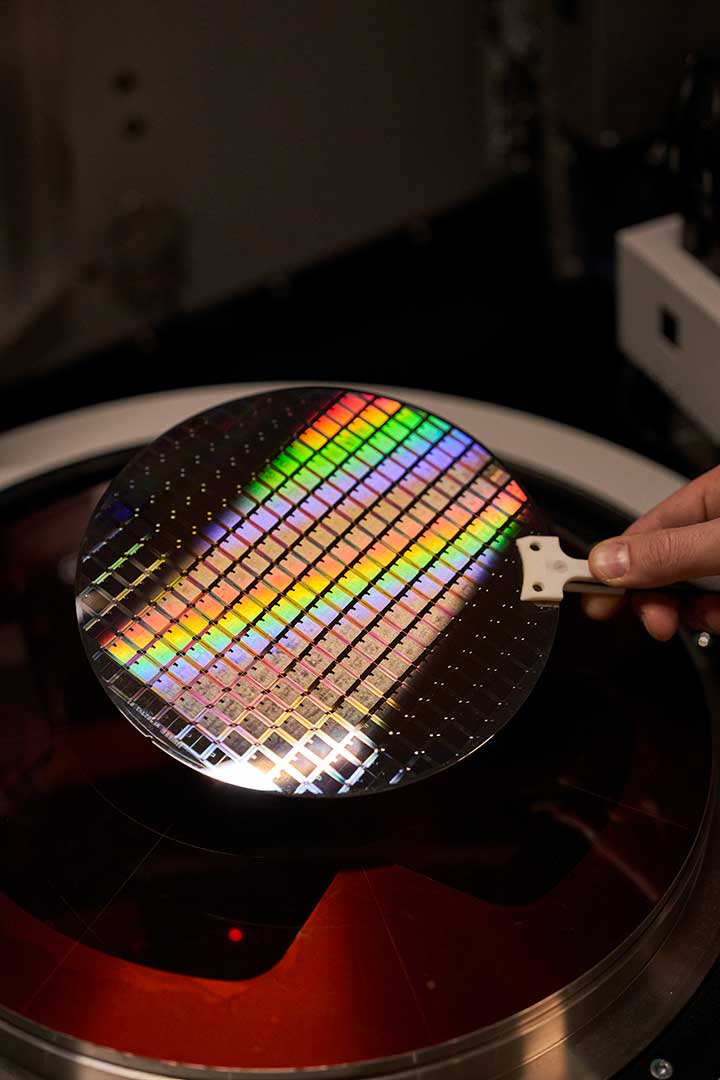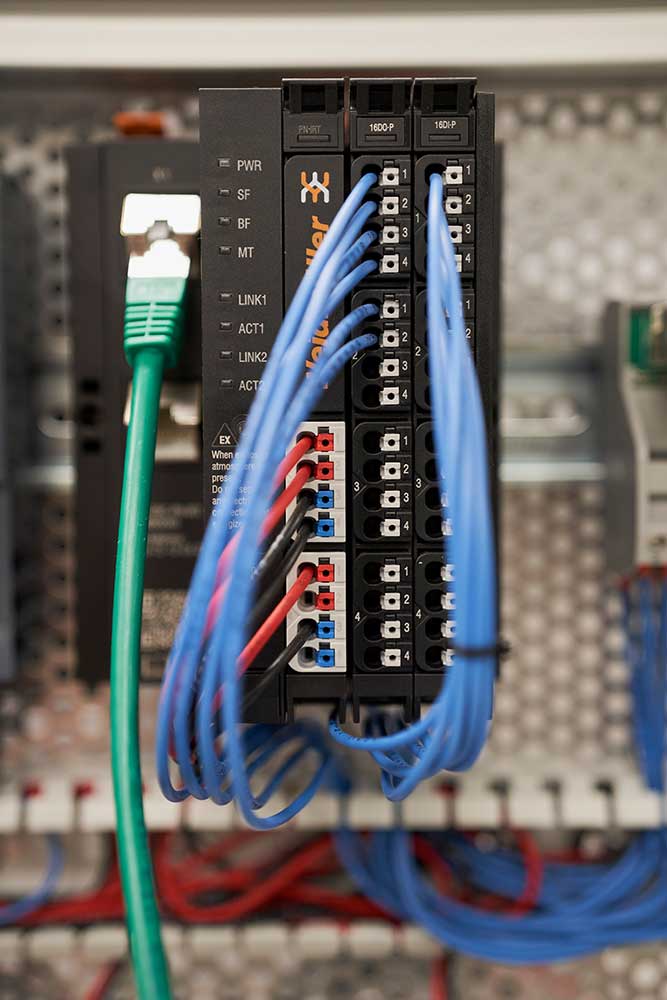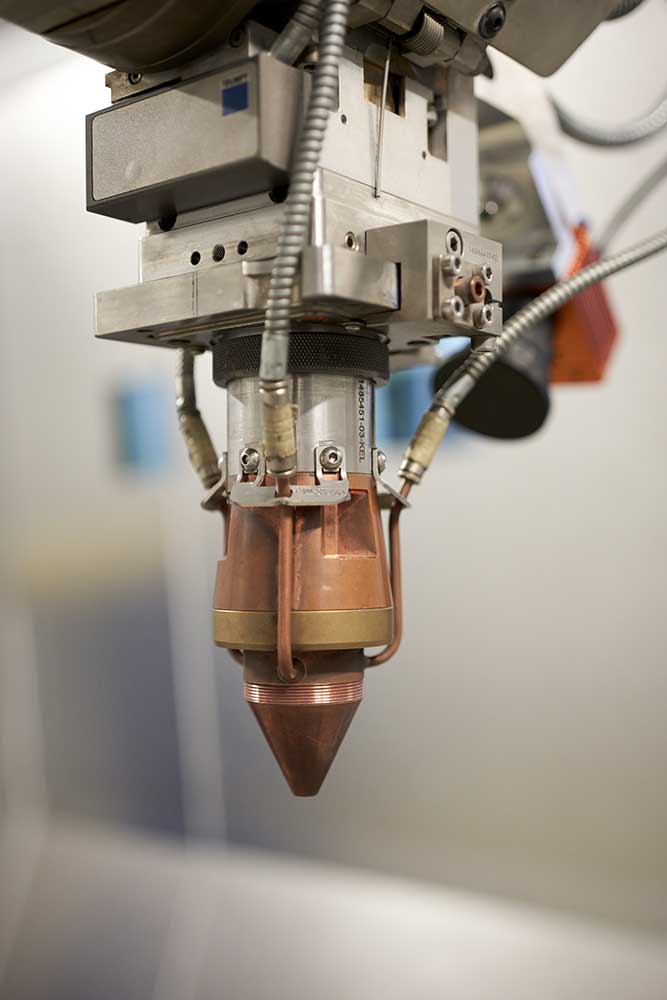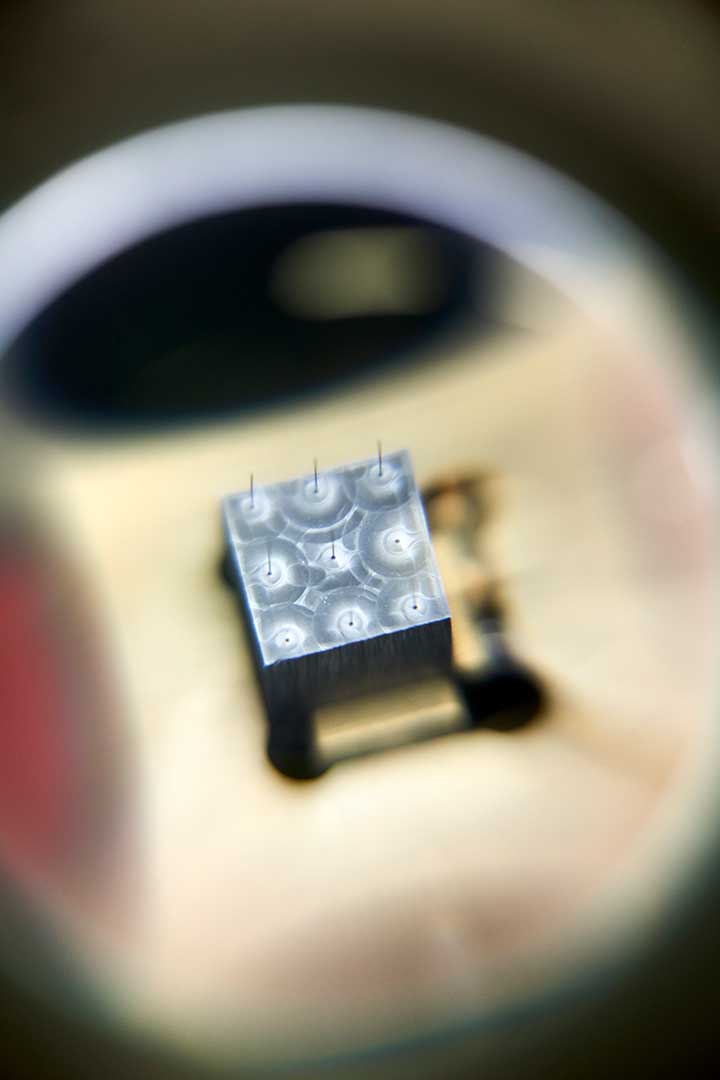Fraunhofer-Köpfe
Dr. Simon Adler
WHAT’S NEXT, SIMON ADLER - MITSPIELEN, WENN ES UM DIE ZUKUNFT GEHT
»Digitalisierung ist kein Selbstzweck.« Beinahe könnte man ihn übersehen, so ruhig und gelassen sitzt Simon Adler in einem der Besprechungszimmer des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF und trinkt Kaffee. Ausgeruht erklärt der Forscher Sinn und Zweck seines Fachgebiets: Derzeit entwickelt Adlers Team in Magdeburg Assistenzsysteme zur Digitalisierung von Fertigungsanlagen. »Auch für kleinere Betriebe ist das reibungslose Zusammenspiel aller Gewerke wichtig. Arbeiter müssen ihre Anlage, komplexe digitale Systeme und die auftretenden Veränderungen darin genauso schnell verstehen wie Ingenieure oder etwa die IT-Abteilung, um sich dazu austauschen und entsprechend handeln zu können. Das funktioniert am besten über augmentierte Realitäten – und über das Visualisieren großer Datenpakete!« Vor diesem Hintergrund programmiert Adler Anwendungen, die ganze Produktionsstraßen nachbilden und den unterschiedlich an der Fertigung Beteiligten zum Beispiel Produktionsstände, Fehler oder Optimierungsbedarfe zeigen – am Tablet oder Handheld. Das funktioniert mitunter hochanschaulich: »Einen Blitz versteht jeder«, führt Adler mit sichtlicher Freude an eindeutigen Veranschaulichungen aus. »Bei einer roten Ampel wissen alle, was zu tun ist. Wir Programmierer sind Dolmetscher, die verschiedene Sprachen und Wissensstände verstehen und die daraus resultierenden Daten dann darstellen müssen.«
»Wir leben in einer merkwürdigen Zeit.« Im Besprechungsraum rückt der Wissenschaftler mit dem freundlichen Gesicht und den neugierigen Augen, die immer etwas zu fragen scheinen, die Kaffeetasse beiseite. »Die Datenwelten werden immer komplexer. Gleichzeitig erwarten die Menschen spielerische, leicht bedienbare Anwendungen.« »Spielerisch« ist für Adler allerdings kein Schimpfwort: Für den ehemaligen Spieleprogrammierer bedeutet »spielerisch« so viel wie »verständlich« – die Königsdisziplin. »Schon neben dem Studium habe ich mir mit Spieleentwicklungen etwas dazuverdient«, lacht der Medieninformatiker. »Ich war jung und brauchte das Geld!« Zu den Kunden des Fraunhofer IFF zählen natürlich keine Game-Anbieter, sondern insbesondere Mittelständler aus der Holz verarbeitenden Industrie, Beton- oder Chemiewerke, denen das Virtual Engineering Lösungen für die Digitalisierung auf den Leib schneidert – und die funktionieren im besten Fall mit spielerischer Leichtigkeit, bisweilen wie eine App. Ganz nebenbei entsteht zu jeder Anlage ein digitaler Zwilling. Durch dieses Wissen ist es möglich, auch KMU, die sonst nicht die Ressourcen zur Digitalisierung hätten, mit dem Wissen und Know-how aus ähnlichen Projekten zu unterstützen und letztlich wettbewerbsfähig zu halten. »Viele unserer Kunden haben beim Thema Daten noch ein großes Fragezeichen«, führt Adler weiter aus. »In der Cloud wird geklaut, heißt es oft.« Zwischen unkritischer »Bei uns geht alles«-Mentalität und panischer Angst vor Datendiebstahl gebe es wenig Abstufungen.
Kurze Zeit später steht Simon Adler im oberen Stock des Fraunhofer IFF vor einem Demonstrator und bespricht sich mit einem jungen Team aus IT-Systemarchitekten und Computervisualisten. Neben einem Smart Grid, das ein Kraftwerk, einen Solarpark und eine Biogasanlage darstellt, fällt eine kleine Pilotanlage auf, die den Wasserdruck eines Tanks überwachen soll. Unerwartet springt eine Ampel auf Gelb, als ein junger Mitarbeiter einen Knopf betätigt: Das Experiment ist – vorerst – gescheitert. »Macht nichts!« Adler schmunzelt. »Wenn auch mal etwas nicht gelingt – das gehört dazu. Wichtig ist, dass wir dranbleiben, es weiter versuchen und nicht an der Seitenlinie stehen. Bislang haben wir immer eine gute Lösung gefunden!«
Der Wissenssammler und -vermittler Simon Adler programmiert »unheimlich gerne« – aus Leidenschaft. »Ein guter Programmierer lernt ständig dazu, führt Fakten zusammen.« Auf dieser Grundlage hat der Informatiker bereits Pflanzen »augmentiert« und dabei gelernt, dass es für einen Baum pro Jahr nicht vier, sondern ganze neun »Jahreszeiten« gibt. In einem anderen Fall erschuf er einen VR-Simulator zum Erproben minimalinvasiver Operationen für Chirurgen. »Solche Eingriffe bedienen sich komplexer technischer Hilfsmittel und Systeme wie der Videoendoskopie, die wir mit unseren Simulatoren trainieren können.« Außerdem geht es beim medizinischen Teil der Arbeit Adlers um Pedikelzugänge in Wirbelsäulen, um das Arbeiten mit handgeführten Robotern und um den Abgleich der operativen Eingriffe vor Ort mit präoperativen Daten. »Um zu lernen, war ich sogar bei Operationen dabei«, erzählt Adler, der jetzt im Elbedome steht. In dem 360-Grad-Mixed-Reality-Labor des Magdeburger Fraunhofer-Instituts lassen sich interaktive Visualisierungen, etwa von Windkraftanlagen, hervorragend großflächig darstellen. Adler bewegt sich mit einer VR-Brille durch den kreisrunden Raum, führt Anwendungen vor, die am Fraunhofer IFF entwickelt wurden – ganz Spielführer im Zentrum der von ihm selbst geschaffenen Welten. »Viele haben Angst vor der Digitalisierung. Ich führe Kundinnen und Kunden dann gerne hierher und zeige ihnen, dass Industrie 4.0 alles andere als langweilig oder gar bedrohlich ist. Außerdem erkläre ich ihnen, dass es Assistenzsysteme, die Produktionsstraßen intelligent machen, unter anderen Namen schon lange gibt. Auch unser Elbedome existiert seit über zehn Jahren. Ganz generell wurden nur neue Schlagworte, neue Begriffe eingeführt, was mein Tätigkeitsfeld betrifft – um den Wandel genauer beschreiben zu können.« Menschen an die Hand nehmen, Lösungen anbieten und auch mit dem guten Namen und dem exzellenten Renommee der Fraunhofer-Gesellschaft Ängste nehmen: all dies trauen wir Simon Adler, Programmierer und Menschenfreund, gerne zu – mit spielerischer Selbstverständlichkeit.
Dr. Simon Adler leitet am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF den Zukunftsbereich Virtual Engineering. Wer ihn einen Tag lang begleitet, entdeckt das freundliche Gesicht von morgen und übermorgen – und lernt, dass Software-Entwickler meist auch Übersetzer sind.
Jörg Amelung
WHAT’S NEXT, JÖRG AMELUNG: UNSER MODELL FÜR DIE ZUKUNFT
Jörg Amelung leitet die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD). Der Zusammenschluss aus elf Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft und zweien der Leibniz-Gemeinschaft versteht sich mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten als maßgeblicher Innovationstreiber auf dem Gebiet der Mikro- und Nanoelektronik. Wie sich Strategie und Schlagkraft der über 2000 beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einer dezentralen Organisationsstruktur verbinden lassen, erklärt Jörg Amelung an einem gut getakteten Arbeitstag.
»Mein Arbeitsplatz ist hier in Berlin. Aber meistens pendle ich zwischen den dreizehn Instituten und meinen beiden Büros in Berlin und Dresden.« Gerade sitzt Jörg Amelung an seinem Schreibtisch im Spreepalais in Berlin und bereitet sich auf die Termine des Tages vor; im Gegensatz zum herrschaftlichen Namen des Gebäudes sind die Offices hier funktional eingerichtet, zugleich aber kommunikativ. Zwei Flügel beherbergen die FMD-Geschäftsstelle, den Kern bildet ein runder Tisch – für den Austausch der Mitarbeitenden sowie mit Vertretern aus Wissenschaft und Industrie.
Zu besprechen gibt es viel. FMD-Leiter Amelung hat sich Großes vorgenommen: »Mikroelektronik europaweit zukunftssicher machen.« Dabei komme außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft eine Schlüsselrolle zu. »Sie haben die Größe und das Know-how, um bei Forschung und Entwicklung zu führen«, erklärt der diplomierte Physiker.
»Aber wie sollen Kunden wissen, welches der Institute das richtige für sie ist? Uns geht es darum, auf die Kunden zuzugehen – passgenaue Angebote zu machen, die Synergien der FMD-Institute zu nutzen und dabei schnell und zugleich konkurrenzlos innovativ zu sein.« Zur Erklärung malt er zwei Pfeile auf ein Blatt. »Dazu verbinden wir das Beste aus zwei Welten: Die Vorteile zweier starker dezentraler Forschungsorganisationen – der Fraunhofer-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft – mit den Vorteilen einer zentralen Organisationsform. Und das mit einer Geschwindigkeit in der Projektabwicklung, wie man sie sonst nur aus der Wirtschaft kennt.« Amelung versieht die Pfeile mit Ausrufezeichen. »Als FMD sind wir ein One-Stop-Shop, der Kunden die Lösung und das Fertigungsmanagement anbietet.« Ein Beispiel hat Amelung schnell zur Hand: Als die Dresdner Fabrikationsstätte des US-Unternehmens Globalfoundries Weiterentwicklungen an ihren Technologien benötigte, konnten die in der FMD vernetzten Institute Spitzen-Know-how zur Evaluierung neuartiger Prozessschritte für zukünftige Fertigungsverfahren anbieten – sofort und passgenau.
»Nur durch konsequente Verknüpfung und strategische Weiterentwicklung der Expertise unserer Institute können wir auch zukünftig die Technologiesouveränität und Attraktivität des Standorts Deutschland für die Spitzenforschung aufrechterhalten!«
Dabei, so führt der Stratege aus, steht einiges auf dem Spiel: Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa will man verhindern, dass immer weitere Teile der Wertschöpfungskette in der Mikroelektronik an andere Regionen der Welt verloren gehen.
Das Thema Smartphone wird bereits von Asien dominiert. Bei Industrieanwendungen ist noch offen, wer die Märkte künftig führen wird. Im Zeitalter von Smart Factory und Industrie 4.0, aber auch durch das autonome Fahren ist die Nachfrage enorm. »Computer, Steuerungsanlagen, ›More than Moore‹-Anwendungen, mit denen die Grenzen der Leistung von Computer-Chips überwunden werden: Mikroelektronik ist überall. Wir müssen unsere Kompetenzen strategisch gebündelt und mit Schlagkraft auf Spur bringen«, erklärt der Wissenschaftler. Die Fraunhofer-Gesellschaft kennt er seit seinem zweiten Fachsemester, als er sich am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS in Duisburg mit Gas- und Drucksensorik beschäftigte. Das war 1989. Seitdem ist er nicht nur als Abteilungsleiter an unterschiedlichen Fraunhofer-Instituten tätig gewesen, er hat auch selbst Ausgründungen betrieben: Das OLED-Unternehmen Novaled, das später an Samsung verkauft wurde, ist nur ein Beispiel.
Sein Büro in Berlin Mitte hat der Netzwerker inzwischen verlassen: Ein Termin bei einem der Berliner FMD-Institute steht an. Mit dem Elektroroller geht es aber erst mal an die Spree, zum Mittagessen mit dem Team. Themen wie Elektromobilität und Energiewende sind Amelung sehr wichtig. Daher steigt Amelung auch oft in die Bahn oder in sein Elektroauto und fährt umweltschonend zu Terminen. Heute geht es zum Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM am Volkspark Humboldthain. Hinter den hohen Backsteinwänden des denkmalgeschützten Gebäudes verbirgt sich eine weltweit führende Einrichtung zur Entwicklung neuartiger Technologien für die Elektronik und deren Systemintegration, für Zukunftsfragen aus der Automobil- und Industrieelektronik, aus Medizintechnik und der Halbleiterfertigung.
Schwungvoll steigt Amelung aus dem Elektroauto. Dann begrüßt er Professor Klaus-Dieter Lang: Mit dem Leiter des Fraunhofer IZM will er heute über Elektronik-Hardware der nächsten Generation sprechen.
Das Fraunhofer IZM ist eines der 13 FMD-Institute und somit Teil Europas größter Forschungsfabrik mit einem Angebot, das von den Grundlagen bis zur Pilotfertigung mikroelektronischer Komponenten reicht – und das gerade in der Gründerhauptstadt Berlin.
»Als erfahrener Ausgründer weiß ich, wie wichtig es für Start-ups ist, möglichst schnell etwas Konkretes vorzeigen zu können«, erklärt Amelung. Zur Gewinnung von Investoren, für Test und Zertifizierung neuer Produkte aber auch für die Erprobung an späteren Nutzern ist ein funktionaler Prototyp notwendig. Deshalb hat die FMD ein spezielles Angebot, den FMD-Space, für Start-ups, Gründer und Erfinder entwickelt. Ein Beispiel findet sich in einem der Labore des Fraunhofer IZM: Beim Projekt angekommen, begutachten Amelung und Lang die am Vortag bestückte Leiterplatte für das Produkt eines Berliner Start-ups: Sie ist flexibel und besteht aus Vlies. Solche extrem belastbaren, textilen Leiterplatten sind äußerst interessant für körpernahe Elektronikanwendungen und damit für Gründerinnen und Gründer, die solche Hardware-Herausforderungen annehmen wollen. »Zwingende Voraussetzung dafür, dass sie ihre Idee eines Systems von morgen einem Kapitalgeber überzeugend präsentieren können, sind solche Prototypen«, so Amelung.
What’s next, Jörg Amelung? Auf dem Weg zurück zum Wagen bleibt noch Zeit für einen knappen Ausblick. »Die Umgebungssensorik wird uns stark beschäftigen – und das Next Generation Computing«, so Amelung. »Wir setzen uns mit neuronalen Systemen auseinander, damit, wie die Architektur von Computern aussehen muss, wenn wesentlich mehr Daten verarbeitet und mehr Leistung und Energie abgefordert wird. Im Bereich der Quantencomputer wurde mit IBM ein Pilotprojekt aufgesetzt: Hier nimmt die Fraunhofer-Gesellschaft den ersten IBM Quantencomputer in Europa in Betrieb. Aufgrund seiner enormen Leistungsfähigkeit ermöglicht es modernste Forschungsarbeiten.«
Mit dem Aufbau eines international konkurrenzfähigen, dezentralen Angebots für die technologische Expertise entlang der gesamten Mikroelektronik-Wertschöpfungskette hat sich die Fraunhofer-Gesellschaft in der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland viel vorgenommen – nicht weniger als ein Zukunftsmodell der deutschen Forschungslandschaft zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen.
Solche Fortschritte sind es, die Jörg Amelung immer weiter antreiben. Das persönliche Vor-Ort-Sein ist ihm wichtig. Auch aus diesem Grund verabschiedet er sich schnell: Der nächste Termin wartet schon.
Dipl.-Ing. Werner Bähr

»Wir arbeiten an einer industriellen Revolution zum Wohle des Menschen! Bis heute habenIndustrie-Revolutionen immer nur die körperliche und einfache Arbeitsleistung durch Maschinen ersetzt. Und auch jetzt bei Industrie 4.0 und der omnipräsenten Künstlichen Intelligenz wird man auf den Menschen, der weiß, worauf es ankommt, nicht verzichten können. In meinem Forschungsgebiet muss man immer auf die relevantenDaten zurückgreifen – nur beliebig gesammelte große Datenmengen können das Problem nicht lösen. Die Routinearbeit wird sicher die Maschine übernehmen, aber der Mensch muss bei Prozessänderungen noch eingreifen können und weiter das Systemverständnis haben!«
Dipl.-Ing. Werner Bähr ist Abteilungsleiter Elektronik für ZfP-Systeme am Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP in Saarbrücken. Der Wissenschaftler hat in über 35 Jahren bei der Fraunhofer-Gesellschaft zahlreiche Großprojekte geleitet, innovative Technologien umgesetzt und in der Industrie etabliert.
Prof. Michael Bartke
WHAT’S NEXT, MICHAEL BARTKE: ZUKUNFT WIRD AUS VIELFALT GEMACHT
Professor Michael Bartke ist Forschungsbereichsleiter am Fraunhofer IAP und leitet das Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum für Polymersynthese und -verarbeitung PAZ in Schkopau. Gemeinsam mit seinen Teams beantwortet er Fragen der Technologieentwicklung und Maßstabsvergrößerung von Polymersynthese- und Verarbeitungsprozessen – und stellt die Zukunftsfähigkeit innovativer Kunststoffe so tagtäglich unter Beweis. Vielseitigkeit und Flexibilität sind dabei Schlüsselfaktoren. Ein Ortstermin.
»Polymere sind viel mehr als die bloße Plastiktüte!« Michael Bartke sitzt in seinem Büro im Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum in Schkopau. Von der frühmorgendlichen Lektüre einer Tageszeitung ist der Forscher nicht begeistert: Die Einseitigkeit des Leitartikels zum Thema Nachhaltigkeit sieht der Fachmann für Polymere und Verfahrenstechnik kritisch. Vor allem, weil es darin heißt, auf Kunststoffe müsse zukünftig verzichtet werden: »Sicher, Plastik in den Weltmeeren ist ein Problem, aber in erster Linie ein gesellschaftliches Problem der Müllerfassung. Aber Polymere, also die Hauptkomponenten bei der Herstellung von Kunststoffen, kommen ja viel umfänglicher zum Einsatz – etwa im Leichtbau. Oder sie schützen Lebensmittel, die sonst verderben würden.« Bartke legt die Zeitung zur Seite. »Polymere sind im täglichen Leben nicht mehr wegzudenken und werden in diversen Anwendungen benötigt. Beispielsweise Elastomere für energieeffiziente Reifen oder auch in der Medizintechnik. Hier finden sie zum Beispiel in Form von künstlichen Herzklappen oder Gelenken Verwendung.«
Der Forschungsbereichsleiter ist kaum zu bremsen. Kein Wunder, schließlich geht es um sein Fachgebiet: Im Pilotanlagenzentrum, an historischer Stätte in Schkopau, dort, wo 1937 zum ersten Mal industriell Synthesekautschuk hergestellt wurde, dreht sich alles um Polymere – innovativ, zukunftsfähig und zum Wohle des Wirtschaftsstandorts Deutschland, wie Bartke weiter ausführt. In unterschiedlich großen Anlagen werden Fragen der Technologieentwicklung und Maßstabsvergrößerung von Polymersynthese- und Verarbeitungsprozessen beantwortet. Hat etwa ein Unternehmen aus der chemischen Industrie einen neuen Kunststoff entwickelt, gilt es im nächsten Schritt die Produktionsverfahren zu entwickeln und optimieren – und Michael Bartke kommt mit seinen Teams ins Spiel. Aber es geht nicht nur um das, was als »Scale-up« die in der chemischen oder biochemischen Verfahrensentwicklung praktizierte Maßstabsvergrößerung von Herstellungsverfahren, das Hochdimensionieren und den Testlauf innovativer Materialien bezeichnet. Im Fraunhofer PAZ werden neue Produkte und innovative Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt – vom Monomer über die Synthese und Verarbeitung von Polymeren bis hin zu dem geprüften Bauteil nach Maß sowie der Bereitstellung von Mustermengen bis in den Tonnenmaßstab.
Die Kunden kommen aus allen Teilen der Welt – von den USA über Europa bis nach Asien reicht das Spektrum. Am Tag unseres Besuchs sind es die Auftraggeber eines deutschen Chemieunternehmens, die Michael Bartkes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Blaumännern auf Trab halten. Ständig klingeln Telefone, werden auf 1000 Quadratmeter Technikumsfläche Ventile auf- und zugedreht, Verfahren am modernen Prozessleitsystem überwacht und gesteuert, Polymerproben analysiert und Daten abgeglichen und ausgewertet.
Am Standort Schkopau bündeln die Fraunhofer-Institute für Angewandte Polymerforschung IAP und für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS ihre Kompetenzen unter einem Dach. »Hier habe ich ein hervorragendes Beispiel für die Vielfältigkeit von Polymeren und die Zusammenarbeit in der Fraunhofer-Gesellschaft!« Michael Bartke stellt sich neben einen Autoreifen, in den Ergebnisse der Elastomer-Forschung genauso eingeflossen sind wie die biowissenschaftlichen Kompetenzen der fünf beteiligten Fraunhofer-Institute und das »Scale-up«-Know-how des Pilotanlagenzentrums: »BISYKA« heißt der biomimetische Synthesekautschuk, aus dem der Reifen besteht. »Wir konnten die besonderen Eigenschaften von Naturkautschuk besser verstehen und damit einen Synthesekautschuk entwickeln, der bei ersten Straßentests im Reifen überzeugen konnte und 30 Prozent weniger Abrieb aufzeigt«, erklärt der Wissenschaftler. Im Ergebnis stelle BISYKA eine Alternative mit hohem Wertschöpfungspotenzial dar, so Bartke – zumal es bei Naturkautschuk aufgrund von ökologischen Problemen und der weltweit zunehmenden Mobilitätsnachfrage zu Verknappungen kommen könne.
»Das ist nur ein Beispiel, das beweist, wie vielfältig Kunststoffe sind – und, wie sie unser Leben besser machen.« Geht es um die Beantwortung von Zukunftsfragen, dann hat Michael Bartke, Vater von drei Kindern und Professor für Polymerisationsreaktionstechnik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, vor allem die Entwicklung bedarfsgerechter Materialien und energie- und rohstoffeffizienter Verfahren im Blick. »Es muss mehr in Systemen gedacht werden«. Um diese mit noch mehr Schlagkraft entwickeln zu können, wird das Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum derzeit erweitert – ein weiterer Beleg für das Potenzial des Standorts. »Mit unseren vielseitigen Polymersyntheseanlagen sind wir gut am Markt positioniert und attraktiv für Absolventen«, führt Bartke weiter aus. Schon ist Michael Bartke auf dem Weg zum nächsten Meeting, die Kundinnen und Kunden des heutigen Tages wollen über die Potenziale einer neuen Kunststoffentwicklung sprechen. Worum geht es genau? »Das ist Zukunftsmusik, das darf ich nicht verraten.« Bartke lacht: »Eins steht fest: Plastiktüten werden heute nicht das Thema sein!« Dann verschwindet der Forscher, die Auftraggeber warten schon gespannt.
Thomas Bergs
WHAT’S NEXT, THOMAS BERGS: GENERATION NEXT
Thomas Bergs leitet als Direktoriumsmitglied des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT in Aachen den Bereich Prozesstechnologie. Der Professor am Lehrstuhl für Technologie der Fertigungsverfahren der RWTH Aachen ist überzeugt: Nur in einer offenen, kollegialen Institutskultur können die immensen Zukunftsaufgaben gelöst werden, die sich der deutschen und europäischen Industrie derzeit stellen. Dabei helfen exzellente Fachkenntnis, Offenheit – und auch mal ein Getränk nach dem Skifahren. Ein Ortstermin.
»Kein Problem!« Thomas Bergs schaut die gut beschneite Talfahrt hinab. »Man muss sich nur trauen!« Dann fährt er den Hügel hinunter: In die Skihalle des »Alpenparks Neuss« zieht es den Ingenieur und passionierten Wintersportler Bergs von Zeit zu Zeit, um abzuschalten – oder um auf neue, inspirierende Gedanken zu kommen.
Inspiration braucht er täglich. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, das Bergs leitet, gehört zusammen mit dem Werkzeugmaschinenlabor WZL der Technischen Hochschule Aachen zu den größten und angesehensten Forschungseinrichtungen für die Produktionstechnik weltweit. Entwickelt werden hier Lösungen nach Maß – für die Produktion von morgen. Denn egal, ob Elektromobilität oder Life Sciences, ob Optik, Leicht- oder Werkzeugbau: Überall gilt es, die Produktion zeitgemäß weiterzuentwickeln. Allein im Automobilbereich reichen die Bedarfe, mit denen die Industrie auf das Fraunhofer-Institut zukommt, von der Fertigung verschiedenster Interieurkomponenten und Karosseriebauteile über den elektrischen Antriebsstrang mit klassischen Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen bis hin zu optischen Elementen für Beleuchtungs- oder Fahrerassistenzsysteme.
»Wir sind in vielem erfolgreich, aber wir müssen auch dranbleiben.« Zu seinem Team zählen Maschinenbauingenieure, Informatiker, Techniker. Die Vielfalt ist Bergs wichtig. »Wenn wir den internationalen Anschluss nicht verpassen wollen, dann müssen wir heute viel mehr als früher out of the box denken.« Im Technikum des Fraunhofer IPT geht Bergs schnellen Schrittes an einer Anlage vorbei, die am Institut für die Bearbeitung von Bauteilen für Flugzeug- oder Gasturbinen eingesetzt wird. »Große Projekte lösen wir nur, wenn wir nicht in engen Korridoren denken. Vor allem brauchen wir technologiebegeisterte Kolleginnen und Kollegen, denen es Spaß macht, in einer offenen, leistungsbereiten Kultur neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen.« Bergs verweilt für einen Moment vor einer Laseranlage. »Nehmen Sie nur die biologische Transformation. Hier wenden wir beispielsweise evolutionäre Prozesse zur Optimierung der Produktion an. Dafür brauchen wir nicht nur Maschinenbauer, sondern auch das Know-how von Biotechnologen und Informatikern. In der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Disziplinen liegt der Schlüssel zu Erkenntnissen, die Deutschland und Europa voranbringen!«
Für Maschinenbauer muss das Technikum des Fraunhofer-Instituts einer Welt der Wunder gleichen: Eine Flugzeugturbine steht neben Maschinen für die Optikfertigung, den Leichtbau und den Werkzeugbau – mitsamt verschiedener weiterer Prototypen für die Energieerzeugung, die Automobilindustrie oder für die Öl- und Gasförderung. »Wer erfolgreich sein will, muss an die nächste Generation denken«, führt Bergs weiter aus. Nicht nur als gute Tradition, sondern auch als einen weiteren Weg, um hervorragend ausgebildete Techniker und Ingenieure persönlich an das Institut zu binden, sieht Bergs daher die jährliche Skifreizeit des Fraunhofer IPT in Südtirol. »Ob die Kolleginnen und Kollegen Ski fahren können oder nicht, ist dabei unerheblich. Es geht um die Gemeinschaft, die Freude und den Austausch – gerne auch bei einem Getränk. Und es geht um die neuen Ideen, die durch die Vernetzung erst möglich werden!«
Ein uneingeschränkter Wille zum Zeitgemäßen zeichnet Thomas Bergs aus. Auch die Büros des Direktoriums am Institut, in die Bergs sich nun begibt, spiegeln diese Haltung: Ein Gemeinschaftsraum, halb Lounge, halb Bibliothek, ist das kommunikative Herz des Instituts. Mit seinem angenehmen, leicht abgedunkelten Licht und den modernen, bunten Sitzmöbeln erinnert es eher an ein Café für junge Leute als an das Vorzimmer zur Geschäftsleitung.
Woher kommen Ihr Engagement und Ihr Elan, Thomas Bergs? »Wir müssen großen Einsatz zeigen, um auch zukünftig in der Produktionstechnologie führen zu können. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat hier Vorbildfunktion in ganz Europa.« Ein Aspekt ist Bergs dabei besonders wichtig: »In unserem Geschäftsbereich geht es längst nicht nur um die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist nur ein Instrument. Worum es geht? Dass wir als Fraunhofer-Gesellschaft mit unserem gigantischen Netzwerk an Wissen Lösungen anbieten, die für die Gesellschaft insgesamt von Nutzen sind. Dieser gesellschaftliche Aspekt wird mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Wenn wir das verstehen, werden wir auch die nächste Generation von Ingenieurinnen und Ingenieuren wieder begeistern können!« Dann verabschiedet sich Thomas Bergs: Der nächste Termin wartet schon. Wer ihm einmal begegnet ist zweifelt nicht daran, dass sie kommen wird, diese »Generation Next«. Und dass sie mit erfahrenen Forschern und Praktikern wie Thomas Bergs Menschen finden wird, die Freude an der angewandten Wissenschaft mit Exzellenz vereinen – und gesellschaftliche Relevanz mit einer Skifreizeit für alle Mitarbeiter.
Prof. Dr. Andrea Büttner
WHAT’S NEXT, ANDREA BÜTTNER: FORSCHUNG MIT SINN(EN)
Prof. Dr. Andrea Büttner ist Teil der Institutsleitung des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV. Von der Aroma- und Geruchsforschung kommend, entwickelt sie Produkte für den Konsum von morgen. Wer die Analytikerin einen Tag lang begleitet, merkt schnell, dass es am Fraunhofer IVV nicht nur um Gerüche und Rezepturen geht: Büttners Team ist auf der Suche nach nachhaltigen Formen des Konsums, die Mensch und Umwelt in Einklang bringen.
Andrea Büttner steht im Eingangsbereich des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising und wird von jungen Lebensmittelforscherinnen und Lebensmittelforschern umringt: Die Institutsleiterin hat Geburtstag. Eines ihrer Teams überreicht eine Torte mit Superwoman-Motiv, und die Münchnerin lacht von Herzen: Mit ihrer Freundlichkeit hat sie, so scheint es, das ganze Institut angesteckt. Auf dem Weg in ihr Büro grüßt Büttner Teams aus dem Technikum und den Laboren; das Interesse gilt der Arbeit der anderen, auch abteilungsübergreifend. Andrea Büttner ist Mutter von drei Kindern, Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Fraunhofer-Führungskraft. Weil sie eine Frau ist, wird ihr oft eine ganz bestimmte Frage gestellt: Wie regelt sie all das, und wie behält sie dabei ihre freundliche, bodenständige Art? Die Antwort kommt blitzschnell: »Es ist eher umgekehrt. Ohne Bodenhaftung könnten wir am Institut keine Erfolge erzielen.«
Andrea Büttner ist Sinnesforscherin, aber auch Analytikerin für Produkte und Prozesse. Sie konzentriert sich darauf, was Verbraucher anspricht. Im Fokus ihres Instituts stehen mehr und mehr Themen wie Umwelt und Recycling. Gerade hier gilt es zu erforschen, wie Menschen auf wiederverwertete Produkte und Verpackungen reagieren – was sie dazu bringt, sie anzunehmen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Interaktion der Sinne: Das Zusammenspiel von Optik, Textur und Geruch beeinflusst maßgeblich das Kaufverhalten. Schließlich hänge an der Nase »ein ganzes Gehirn«, so die Wissenschaftlerin. Und das Fraunhofer IVV arbeitet daran, zu verstehen, wie dieses Gehirn funktioniert – um dann abteilungsübergreifend entsprechende Produkte zu charakterisieren und weiterzuentwickeln.
Mit einem Betriebshaushalt von über 22 Millionen Euro und insgesamt 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden am Fraunhofer IVV für Auftraggeber aus der Industrie Herstellungs- und Verfahrenstechniken erarbeitet, die den Konsum verändern können. »Unser Institut entwickelt beispielsweise Prozesse zur Gewinnung und Verarbeitung pflanzlicher Rohstoffe, unter anderem durch Fermentation. Hierbei geht es um das gezielte Umwandeln organischer Stoffe durch Mikroorganismen bzw. Enzyme. Das Ziel ist es, langfristig tierische Rohstoffe zu ersetzen und so die Tierhaltung einzugrenzen, und zugleich Produkte zu entwickeln, die schmecken und gut sind für die Gesundheit«, erklärt die Forscherin. »Nehmen Sie als Beispiel nur pflanzliches Protein. Das kann eine echte Alternative zu Käse und Joghurt sein.«
Ein Ergebnis ist das am IVV entwickelte Lupineneis ›Lupinesse‹. Das Eis, das in einer großen Supermarktkette landesweit erhältlich ist, wird am Fraunhofer IVV in einer Glasvitrine ausgestellt. »Hier haben Verfahrenstechnik und sensorische Forschung exzellent zusammengearbeitet«, erklärt die Professorin. Dann berichtet sie, wie bei der Entwicklung Lupinenproteine isoliert, veredelt und in Rezeptur gebracht wurden, wie die Abteilungen des Hauses pflanzliche Öle ›formulierten‹, Aromen auf die neue Rezeptur anpassten. Andrea Büttner spielt im Team: »Das ist schließlich meine Aufgabe als Institutsleiterin – Expertisen stärken und zusammenbringen.«
Frage an die Expertin: Wie werden wir morgen einkaufen? »Den Supermarkt, wie wir ihn heute kennen, wird es womöglich in Zukunft nicht mehr geben. Wir müssen Konsum an vielen Stellen ganz neu denken, sonst zerstören wir unsere Lebensgrundlage. Hier am Institut werden wir als Nächstes an neuen Verpackungs- oder Vertriebskonzepten arbeiten, mit denen wir einen Paradigmenwechsel unterstützen möchten«, sagt Andrea Büttner. Und sie fügt hinzu: »Die Bereitschaft zum Umdenken nimmt massiv zu. Die Welt sieht, dass etwas passieren muss – und wir hier am Fraunhofer IVV sind am Rotieren, um den Bedarf zu bedienen und neue Lösungen und Antworten zu finden.«
Am frühen Nachmittag steht Andrea Büttner mit Doktorandin Bianca Lok im Chemielabor des Instituts und überprüft Recyclate in Gefäßen. Hoch konzentriert setzt sich die Nachwuchswissenschaftlerin ihres Teams vor ein Olfaktometer, ein Gerät, mit dem sich Gerüche präzise dosieren lassen. Ihre Reaktionen auf den Geruch, beispielsweise Atmung und Herzschlag, werden mit verschiedenen Systemen erfasst Oft sind es sogar unbewusst wahrgenommene Gerüche oder unterschwellige Reize, die in den Probanden eine Reaktion auslösen, und gerade bei Produkten der modernen Welt sind diese Reaktionen besonders interessant und wichtig. »Wir sind auf der Suche nach Geruch- und Reizstoffen, die heute oft noch weitgehend unbekannt sind und die in Produkten nicht auftreten dürfen. Und eine wichtige Aufgabe ist gerade, Recyclingmaterialien zu entwickeln, die nicht mehr riechen – und neuen Plastikverpackungen in nichts nachstehen«, sagt Bianca Lok. Der Durchbruch gelingt heute noch nicht. Aber das Team von Frau Büttner ist anderen Forschergruppen um mehrere Nasenlängen voraus. Denn sie sind diejenigen, die wissen, wonach sie suchen. Und vor allem, was sie tun müssen, um Produkte zu optimieren und Schadstoffe zu vermeiden.
Energie tankt Andrea Büttner an solchen Tagen am liebsten im Garten ihres Instituts. Das große Gatter öffnen, ein paar Früchte prüfen: Das bringt die Freude zurück. »Mir ist es wichtig, etwas in den Händen zu halten. Mein Vater war Schreiner. Ich fand es gigantisch, wenn ein Schrank als Ergebnis seiner Arbeit im kleinen Betrieb entstand. Ganz zu schweigen von dem Geruch. Deshalb ist natürlich auch Holz, mit all seinen Produkten, ein neues wichtiges Forschungsfeld für uns.« Weil ihr früh klar war, dass die Schreinerei nicht ihr Fachgebiet werden würde, immatrikulierte sich Büttner als eine von fünf zugelassenen Studierenden pro Semester an der Münchner LMU für Lebensmittelchemie. »Mich begeisterte schon damals, wie die Disziplinen ineinandergreifen: Mikrobiologie, Biochemie, Lebensmittelrecht, Verfahrenstechnologie, Ernährungsphysiologie, Medizin, Toxikologie.
Am Ende des Tages verabschiedet sich Andrea Büttner mit einem Ernährungstipp aus ihrer Praxis als Lebensmittelchemikerin: »Essen Sie möglichst vielseitig – bei einer breiten Diversifizierung sinkt das Vergiftungsrisiko enorm!« Dann beißt sie in eine saftige Frucht. »Sehen Sie«, sagt sie, »es schmeckt!« Und es scheint, als sei die tägliche Beschäftigung mit allen Sinnen das schönste Geburtstagsgeschenk, das man der Aromaforscherin machen kann.
Dr.-Ing. Thomas Dallmann
WHAT’S NEXT, THOMAS DALLMANN: DIE ZUKUNFT AUF DEM RADAR
Dr.-Ing. Thomas Dallmann ist Teamleiter der Forschungsgruppe Aachen des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR. Über den Austausch zwischen Universität und angewandter Forschung und über die Zukunft von Radarsystemen sprach Dallmann bei einem Ortstermin.
Die Zukunft entsteht in der Melatener Straße in Aachen, in einem Bau, ausgerechnet, der wirkt wie aus der Zeit gefallen: Der Hochschul-Solitär aus den 1950er-Jahren gehört zur RWTH Aachen, der größten Hochschule für technische Studiengänge in Deutschland. Hier arbeitet Thomas Dallmann mit seiner Forschungsgruppe, die eigentlich zum Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR in Wachtberg gehört. Der Mittdreißiger führt seine Besucher in den ersten Stock des Instituts, um ein Kernstück seiner Arbeit vorzustellen.
Dallmann referiert über ein Forschungsprojekt, mit dem Kunden aus dem Automobilbereich und Zulieferer neue Radare viel einfacher testen können als bisher: ATRIUM ist eine Art virtuelle Umgebung, die einer hohen Zahl verschiedenartiger Fahrzeugtypen angepasst werden kann und mit der sich das Verhalten neuer Technik auch in komplexen Verkehrssituationen exakt überprüfen lässt – für eine schnellere, kostenschonende Entwicklung neuer, fehlerfrei funktionierender Radare. Und Radarsensoren werden zukünftig schließlich noch relevanter, weil sie anstelle der Passagiere in selbstfahrenden Autos durchgängig auf den Verkehr achten. Bereits heute erkennen Radarsensoren selbstständig Hindernisse und leiten Bremsungen ein. »Derzeit werden solche Sensoren auf mehreren Tausend Kilometer Fahrtstrecke getestet.« Thomas Dallmann schaut versonnen aus dem Fenster. »Das ist ein ausgesprochen zeit- und kostenintensiver Prozess – und einer, dessen Sicherheit bisweilen noch zu wünschen übrig lässt.« Mit ATRIUM können viele dieser Tests ins Labor verlegt werden; erläutern lässt sich dies anhand der heute angeschlossenen Version des Simulators. »Mittels Radarzielsensoren können wir Fahrszenarien nachbauen und damit ganze Echolandschaften simulieren«, erklärt Dallmann. »Radarsensoren, welche darauf basieren, Signale auszusenden und deren Reflektionen wieder zu empfangen, benötigen solche Echolandschaften, um anhand der Empfangssignale die sie umgebenden Objekte detektieren und analysieren zu können.« Menschen, Ampeln, Bäume, Autos: bis zu 300 Reflexionen wird ATRIUM bald generieren können, da ist sich Dallmann sicher. »Damit können wir neue Sensoren für das autonome Fahren realitätsnah in vollem Umfang testen.«
Ganz generell ist Thomas Dallmann überzeugt, dass die Präsenz von Radarsystemen zunehmen wird – weit über den Bereich des autonomen Fahrens hinaus. »Netzwerke von Radaren werden immer relevanter – vor allem angesichts intelligenter, vernetzter Fabriken, die ohne Radar kaum funktionieren werden«, so der Wissenschaftler. Insgesamt würden die Anwendungen aber immer kleiner – wie etwa beim gestengesteuerten Google-Handy Pixel 4, das kleine Fingerbewegungen bereits mit dem Radar-Chip »Soli« erkennt.
Dallmann selbst nahm übrigens schon als Schüler mit einem Funkpeilsystem an »Jugend forscht« teil, bevor er Elektrotechnik und Informationstechnik an der Exzellenzuniversität RWTH Aachen studierte. Danach war er erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Hochfrequenztechnik der RWTH tätig, dann als Teamleiter der Forschungsgruppe Aachen des Fraunhofer FHR. »Dass wir vom Fraunhofer-Institut aus als eine Art Satellit mitten in der Universität sitzen, von diesem Wissenstransfer profitieren Forschung und Hochschule gleichermaßen.« Auf der Autofahrt zum Fraunhofer-Institut in Wachtberg gerät der Forscher ins Schwärmen. »Das Fraunhofer FHR ist eines der größten Radarinstitute der Welt. Hier sehen wir eindrucksvoll, was für eine Bandbreite Radartechnologie heute in Forschung und Anwendung bietet.«
Das Thomas Dallmann zugeordnete Fraunhofer-Institut in Wachtberg bei Bonn erkennt man schon von Weitem an einem ganz besonderen Wahrzeichen: Das Weltraumbeobachtungsradar TIRA, eine kreisrunde Radarkuppel, ist mit seinem beeindruckenden Durchmesser von 47,5 Metern nicht zu übersehen. Im Auftrag von Raumfahrtorganisationen aus der ganzen Welt werden mit seiner Hilfe Radarverfahren zur Erfassung und Aufklärung von Objekten im Weltall entwickelt – von der Interkontinentalrakete bis hin zum Elektroschrott. Im Inneren der in Europa einzigartigen Kugel indes ist der Forscher nur sehr selten anzutreffen: Zwar sei das Radom vor Ort das größte der Welt. Mit seiner Forschungsgruppe beschäftige er sich aber, gewissermaßen gegenteilig, mit den allerkleinsten Anwendungen von Radar in Sensorform. Aber, das weiß Thomas Dallmann ganz genau: »Auch die kommen jetzt schon ganz groß raus!«
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Keming Du

»Meine Zukunftsvision? Eine ›smarte Gesellschaft‹ der Zukunft, in der KI, Haushaltsroboter oder Fernmedizin das Leben älterer Menschen unterstützen. Mein Forschungsbereich, die Lasertechnologie, spielt eine unverzichtbare Rolle, wenn es um die Produktion von multifunktionalen, intelligenten Geräten geht. Ich denke da beispielsweise an hochbrillante und flexible Displays. Hier ist eine Präzision erforderlich, die heute zunehmend von Ultrakurzpulslasern generiert wird.«
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Keming Du ist ein renommierter Pionier in der industriellen Lasertechnik und hat am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen gearbeitet, zuletzt als Abteilungsleiter für Hochleistungslaser. 2001 gründete er die EdgeWave GmbH, die innovative Lasertechnologien anbietet.
Dr. Claudia Gärtner
WHAT’S NEXT, CLAUDIA GÄRTNER: KLEINE ZUKUNFT, RIESENGROSS
Die Firma microfluidic ChipShop der Gründerin und Fraunhofer-Alumna Dr. Claudia Gärtner entwickelt und fertigt Mini-Labore, sogenannte Lab-on-a-Chip-Systeme, im Streichholzschachtel-Format. Sie ist Trendsetterin dieser Technologie und zählt zu den Weltmarktführern. Forschung und Entwicklung werden im Unternehmen groß geschrieben. Mit dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena kooperiert Gärtner intensiv – zur Entwicklung der nächsten Generationen voll miniaturisierter biologischer und chemischer Labore. Die Chefin überzeugt dabei mit Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und Unternehmergeist.
Wenn Claudia Gärtner mit ihrem Sohn in den USA ist, heißt dies nicht Urlaub, sondern »ChipShop«: Der 17-Jährige ist bei Kunden und Forschungspartnern vor Ort und in der Mikrofluidikszene schon fest eingeführt. »Mit einer Exportquote von 80 Prozent sind wir permanent unterwegs«, fügt die Gründerin hinzu.
An einem strahlend schönen Morgen sitzt Claudia Gärtner kerzengerade am Konferenztisch ihres Büros in einem Technologiepark am Rande Jenas, der Heimat von Carl Zeiss, Schott und Co. Thüringens »Unternehmerin des Jahres« gerät ins Schwärmen, wenn sie von den Förderstrukturen in den USA spricht: »In Deutschland stimmen die Labore, passt die Forschung. Aber wir müssen unsere Patente besser nutzen, müssen mehr in Richtung Markt denken!«
Ist der Standort Jena für Hightechunternehmen nicht auch ein Erfolgsfaktor? Immerhin können hier durch Technologie- und Forschungspartner vor Ort, durch Unterstützung von Stadt und Land Ansiedlungen von Firmen exzellent umgesetzt werden. »Sicher – wenn Deutschland, dann Jena!« Die Chemikerin betont aber auch, dass man mehr tun könne. Auf ihrer Wunschliste steht ein offenerer Umgang mit Patenten – nur so würden aus den hervorragenden Ergebnissen der öffentlich geförderten Projekte auch tatsächlich erfolgreiche Innovationen.
Gärtner weiß, wovon sie spricht: Ihr Unternehmen ist seit 17 Jahren erfolgreich am Markt; mit inzwischen 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist man international aktiv. Als »beispielhaft« für das »stürmisch wachsende Geschäft mit Mikro- und Nanotechnik« bezeichnete das Wirtschaftsmagazin »Bilanz« ChipShop bereits 2014 – und zitierte die Wirtschaftsberater von McKinsey, die dem Mikro- und Nanotechnologie-Bereich ein Milliardenwachstum prophezeiten.
Wer ChipShop besucht, der spürt, dass die Prognosen stimmen. in den Reinräumen und Laboren, Besprechungszimmern und Fluren des Firmengebäudes herrscht hoch konzentrierte Betriebsamkeit. Teams aus den Ingenieurwissenschaften, aus Physik, Biologie, Chemie und Werkzeugbau bilden eine bunte, aber aufgeräumte Mischung, die hervorragend in das multikulturell geprägte, Hightech-affine Jena passt. Jedem Bereich des Hauses ist eine Farbe zugewiesen; die Chefin arbeitet in fliederfarbener Umgebung. »Wir haben als Büro und Labor mit zwei Personen angefangen«, erinnert sich Gärtner. Vor der Selbstständigkeit mit eigenem Unternehmen hatte sie bei Fraunhofer gearbeitet. Ihr war klar geworden, dass eine große Nachfrage nach »Streichholzschachtel-Laboren« bestand. Dies war die Geburtsstunde von ChipShop: Die Ausgründung wurde vom Applikationszentrum Mikrotechnik Jena und dem Fraunhofer IOF unterstützt.
Der Weg von ChipShop führte dann über ein Gründerzentrum, etliche Jahre im Gebäude von Carl-Zeiss-Jena und 2011 in das eigene Gebäude. Anwendungen sind hier und heute weit über den medizinischen Bereich hinaus zu finden. In den Laboren sind Schnelltests für den Pilzbefall von Getreide, die Wasserqualität oder Analysesysteme für die Qualität von Weinen zu finden; auch Tropenkrankheiten oder Grippeinfektionen lassen sich mit Gärtners Systemen nachweisen. Wird sie nach den Alleinstellungsmerkmalen ihres Unternehmens gefragt, listet Claudia Gärtner drei Faktoren auf: Zum einen bietet ChipShop Standardkomponenten für den Einstieg in die Mikrofluidik an. Maßgeschneidert ist das Angebot der vollständigen Technologiekette vom Verbrauchsartikel Chip über das Betriebsgerät hin zum biologischen Testverfahren. Ziemlich einzigartig – zumindest in diesem Segment – ist auch die Unternehmensstruktur: 100 Prozent der Anteile sind in der Hand der Gründerin. Gärtner beschreibt dies so: »Wir sind ein typisch deutsches, mittelständisches Unternehmen: Eigentümergeführt, von Beginn an profitabel mit einer einzigartigen technologischen Expertise und auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet.«
Am frühen Nachmittag besucht Claudia Gärtner ihren früheren Arbeitgeber, das Fraunhofer IOF. Gemeinsam mit dem Wissenschaftler Falk Kemper hat sie hier gerade ein Projekt aus dem Bereich der gedruckten Elektronik abgeschlossen, das Anschlussprojekt läuft mit kanadischen Partnern. Beide beugen sich über einen Einweg-Chip und ein Mini-Gerät, das es marktfähig zu machen gilt. Ein gemeinsames Ziel ist, mit gedruckter Elektronik, Chip und Smartphone Krankheitserreger künftig mit nur einem Tropfen Blut in wenigen Minuten nachzuweisen.
»So lässt sich in manchen Fällen vor Ort beantworten, ob hinter einem Magengrummeln eine ausgemachte Infektionskrankheit steckt«, erklärt Gärtner. Ihren Erfindungsreichtum, insbesondere aber auch ihr Durchsetzungsvermögen auf dem Weltmarkt begründet die sympathische Schnellrednerin so: »Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, meine Eltern sind selbständig. Die Devise war immer: Du kannst alles erreichen. Du musst halt dafür arbeiten!« Wird es Frauen hierzulande nicht eigentlich recht schwer gemacht? »Das ist völliger Käse!« Gärtner freut es sichtlich, dass sie anderer Meinung ist als ihr Gegenüber. »Ich habe keinen Moment darüber nachgedacht, ob sich drei Kinder und Selbstständigkeit vereinbaren lassen. Ich habe es einfach gemacht!«
Den Abend verbringt Claudia Gärtner Zuhause. Das Familienpferd versorgen, Interviewfragen beantworten, sich auf eine Telefonkonferenz vorbereiten und für Sohn Finn kochen – irgendwie schafft sie das alles gleichzeitig. »Für uns war es immer selbstverständlich, im Betrieb zu helfen«, erzählt Finn. Mit Blick auf ihren Sohn beantwortet die Gründerin auch die Frage: What’s next? »Wir werden eine Beteiligungsfirma aus der Taufe heben, die junge Unternehmer unterstützt. Gelebtes Unternehmertum, Spaß an der Sache und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen möchte ich den Heranwachsenden mitgeben – so wie ich es erfahren habe. Eine Firma, komplett von Jugendlichen betrieben, das wäre doch mal was!« Und schon verabschiedet sich die Wissenschaftlerin, Unternehmerin und Mutter zu einer Skype-Konferenz mit US-Kunden: In Amerika hat der Tag gerade erst begonnen.
Dr.-Ing. Horst Gieser

»Ich sehe in der Zukunft eine Welt voller Chancen bei der Suche nach einfachen, zuverlässigen und sicheren Lösungen für immer komplexere Herausforderungen. Daran arbeiten begeisterungsfähige, interdisziplinäre Fraunhofer-Teams: Sie vereinen Praxisbezug mit forschender Neugier über Grenzen hinweg. Ich freue mich darauf, aus meiner langjährigen Erfahrung in der Mikroelektronik heraus, auch künftig Aufgaben zu analysieren, Impulse zu setzen und innovative Lösungen anzubieten.«
Dr.-Ing. Horst Gieser ist Gruppenleiter an der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT in München. Mit seinem Team hat er unter anderem eine Testmethode für die Charakterisierung und Qualifikation von integrierten Schaltungen erfunden und weltweit etabliert.
Prof. Dr. Stefan Glunz

»Welche Erfindung wir bei Fraunhofer in Zukunft machen sollten? Als Star-Trek-Fan würde ich sagen: Beamen! Aber da wir beim Heisenberg-Kompensator noch immer nicht weitergekommen sind, sollten wir es eine Nummer kleiner halten: Ich wünsche mir eine Solarzelle, die elektrische Ladung speichern kann, um den Umbau des Energiesystems zu erleichtern. Übrigens war Solarenergie, als ich vor 25 Jahren am Fraunhofer ISE angefangen habe, eine Vision für wenige. Jetzt ist sie Realität. Und wir forschen weiter, um den Wandel hin zu erneuerbaren Energien voranzutreiben.«
Prof. Dr. Stefan Glunz ist Bereichsleiter »Photovoltaik – Forschung« am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und lehrt an der Albert- Ludwigs-Universität Freiburg. Das Fraunhofer ISE erzielt immer neue Effizienzrekorde für Solarzellen und trägt zum weltweiten Erfolg der Photovoltaik bei: So hält es mit 22,3 Prozent den Weltrekordwirkungsgrad für multikristalline Siliciumsolarzellen – und einen Spitzenwert für die Wandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie von 46,1 Prozent.
Dr. Stephanie Günther
»Mein Zukunftsziel: eine effiziente und umweltverträgliche Luftfahrt!«
Dr. Stephanie Günther arbeitet am Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI in Freiburg. Warum die Historikerin ihren Job in einem Museum gegen das Abenteuer saubere Luftfahrt eingetauscht hat und sich auf eine Zukunft mit Lufttaxis freut, erzählt sie im Interview.
Promoviert haben Sie in Neuerer und Neuester Geschichte. Fühlen Sie sich heute im Forschungsumfeld der Fraunhofer-Gesellschaft zu Hause?
Ja, sehr. Tatsächlich ist die Fraunhofer-Gesellschaft das Beste, was mir passieren konnte. Die Geschichtswissenschaften beschäftigen sich mit den Strategien der Vergangenheit. Bei Fraunhofer ist mein Thema heute die Strategie der Zukunft: Es geht darum, die wichtigen Themen zu identifizieren und danach zu fragen, wo die Chancen für die Zukunft liegen.
Das tun Sie gerade im Rahmen des EU-Projekts Clean Sky 2. Was ist zum Beispiel Ihre Aufgabe beim derzeit größten europäischen Luftfahrt-Forschungsprogramm?
Ich bin im strategischen Management an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft tätig. Das ist besonders spannend – gehört es doch zu den Zielen der europäischen Luftfahrt, die Lärmbelästigung um 65 Prozent zu senken, die CO2-Emissionen um 75 Prozent und die Stickoxidemissionen um 90 Prozent. Hier will auch Clean Sky 2 einen Beitrag leisten. Gleichzeitig soll für die Materialien und Komponenten der Flugzeuge ein ökologischer Lebenszyklus eingeführt werden, der Entwicklung, Herstellung, Wartung und Recycling berücksichtigt. Zu einer effizienteren und umweltverträglicheren Luftfahrt der Zukunft beitragen zu können ist eine sehr erfüllende Aufgabe.
Gibt es noch etwas anderes, worauf Sie ganz persönlich in der Zukunft gespannt sind?
Es klingt nach Science-Fiction, aber ich glaube, dass Lufttaxis zur Entlastung des Nahverkehrs in großen Ballungszentren die Zukunft sein werden.
Dr. Stephanie Günther ist Geschäftsfeldmanagerin für Luftfahrt am Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI in Freiburg und Expertin für öffentliche Forschungsförderung. Im Rahmen des Luftfahrt-Forschungsprogramms Clean Sky 2 vertritt sie die Interessen der Fraunhofer-Gesellschaft in einem Gremium aus Vertretern von EU-Kommission, Luftfahrtindustrie und anderen Forschungspartnern.
Dr.-Ing. Udo Gommel
WHAT’S NEXT, UDO GOMMEL:WIE REINHEIT HIGHTECH MÖGLICH MACHT
Nach einem kräftigen Regen ist die Luft frisch und klar, als Udo Gommel am frühen Morgen an seinem Schreibtisch im ersten Stock des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA Platz nimmt. Lange hält es den Leiter der Abteilung Reinst- und Mikroproduktion nicht auf seinem Stuhl; Udo Gommel ist ein Bewegungsmensch. »Wir Reinraumspezialisten sind halt dynamische Typen. Schließlich ermöglich wir die Hightech der Zukunft. Die Schlüsselindustrien von morgen kommen nur mit Reinheitstechnik voran«, führt er aus. »Von der Batterieproduktion bis zur Biotechnik – wegen des hohen Miniaturisierungsgrads ist Reinheit entscheidend.«
Als Rein- oder Reinstraum werden Orte bezeichnet, in denen die Konzentration luftgetragener Teilchen – also sämtlicher Partikel und Stoffe, die in der Luft schweben –besonders gering gehalten wird. In der Lasertechnologie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Nanotechnologie ist genau diese absolute Sauberkeit gefragt, damit Mikropartikel die Funktionsfähigkeit von mikroskopisch kleiner Komponenten nicht beeinträchtigen. Folglich kann sich Gommels Team vor Aufträgen kaum noch retten. Die Augen des Wissenschaftlers strahlen. »Nehmen wir nur die Qualität von Mikrochips. Sie ist stark von der Luftfeuchte abhängig, in der sie produziert werden – von der Kombination aus Partikelfreiheit, Chemikalienfreiheit und Restfeuchte«, so der Experte. »Viele Anwendungen funktionieren hier nur unter extremer Sauberkeit: hochpräzise, keim- und kontaminationsfrei.« Mit seinem Know-how berät der Forscher täglich Partner aus der Industrie. Von der Konzeptionsphase bis zur Inbetriebnahme ganzer Fertigungsstraßen führt er Analysen im Ultraspurenbereich durch, optimiert und zertifiziert Maschinen, setzt die reinheitstechnische Planung und Auslegung um. So werden jährlich mehrere hundert Industrieprojekte realisiert, womit das Fraunhofer IPA einen beachtlichen Anteil seines Projektvolumens von insgesamt 70 Millionen Euro erwirtschaftet.
Am frühen Vormittag beschäftigt sich Udo Gommel mit der eingehenden Post des Tages. Der Wissenschaftler ist ein geschätzter Redner, und so liegt wieder einmal eine Anfrage auf seinem Tisch, dieses Mal für einen Fachvortrag auf einer Tagung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Über 50 wesentliche, international relevante Normen und Methoden zur Kontaminationskontrolle und Bewertung reinheitstauglicher Anlagen wurden unter seiner Leitung oder Mitarbeit entwickelt und zwischenzeitlich tausendfach von Unternehmen in Anspruch genommen. Begonnen hat das bereits mit seiner Doktorarbeit, in der der junge Physikstudent ein Verfahren zur Überprüfung der Reinraumfähigkeit von Gerätschaften präsentierte, das bis heute über zweitausendmal Verwendung fand. Gommel lächelt. »Mich interessiert Forschung, die umgesetzt wird, die nützlich ist. IT-Security, Kameratechniken und Sensoren, die das Leben sicherer machen: Das alles wird mit Reinheitstechnik aufgebaut. Das ist doch ein hoch interessantes Themenfeld!« Beim Nutzwert indes geht es nicht nur um die Wirtschaft. Immerhin ist die Reinheit der Meere und der Luft ein gesamtgesellschaftliches Thema – und ein weiterer Fokus des Fraunhofer IPA. »Die Luft draußen nehmen Sie mit Sicherheit als sauber wahr.« Udo Gommel schaut nachdenklich aus dem Fenster; es hat wieder zu regnen begonnen. »Wussten Sie, dass jeder Mensch 5 Gramm Mikroplastik pro Woche zu sich nimmt? Das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte! Unglaublich, oder? Hier warten immense Herausforderungen auf uns.« Wieder klingelt es. »Endlich! Mein Team ist da. Lassen Sie uns den Reinraum betreten!« Schnell geht es ein Stockwerk tiefer, wo sich ein halbes Dutzend Wissenschaftler in den reinsten Analysebereich der Welt schleusen lässt. Der ist zehnmal sauberer, als es die höchste Luftreinheitsklasse ISO 1 vorgibt – höchstens zehn Nanopartikel dürfen hier in einem Kubikmeter Luft schweben. »Das ist so, als hätte jemand das gesamte Volumen des Mondes komplett leer gesaugt – und dabei zehn Kugeln mit einem Radius von je 1 Meter vergessen«, erklärt Gommel. Ein normales Büro erreiche meist Klasse 9; in der Luft schweben dann Milliarden kleiner Partikel.
Im Inneren des Reinraums überprüft sein Team einen Roboterarm; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Mundschutz, verständigen sich in Zeichensprache. Wer eine Kamera einschleusen und filmen will, muss dafür knapp drei Stunden Zeit mitbringen – so streng sind die Vorgaben, damit im reinsten Reinraum der Welt auch alles sauber bleibt. Gommel selbst spricht per Kastentelefon mit jungen Doktorandinnen und Doktoranden. Sie testen neue Funktionalitäten von CAPE, einem zeltähnlichen System, das sich in einer Stunde aufbauen lässt – ein ›Reinraum on Demand‹. Andere Anwendungen, mit denen regelmäßig gearbeitet wird, sind Riboflavintest und CO2-Verfahren. Während bei Ersterem fluoreszierende Partikel zum Einsatz kommen, ist es beim zweiten Schnee: »Um Anlagen, Maschinen und Produkte wirklich rein zu halten, hilft das Absaugen von Partikeln allein nicht. Beim CO2-Verfahren verwenden wir Schneekristalle. Verunreinigungen werden zunächst durch das sehr kalte CO2 versprödet, dann bei der exposionsartigen, ca. 600-fachen CO2 -Volumenvergrößerung von der Oberfläche regelrecht abgesprengt, um abschließend abgesaugt zu werden.
Mitreißend erzählt der Reinraumtechniker von seinem Expertenteam aus den Bereichen Maschinenbau und Ingenieurwissenschaft, Geologie und Verfahrenstechnik – von Schmierstoffen und Absaugungen, Montageprinzipien und Oberflächenmodifikationen. Ist er jeden Tag so energiegeladen? »Mir ist wichtig, Interesse an der Forschungsleistung zu wecken.«, sagt Udo Gommel. Die Verantwortung ist groß. In einer aktuellen Projektierung beträgt das Investitionsvolumen der Gesamtanlage, die mithilfe der Leistungen des Instituts konzipiert, aufgebaut und bewertet werden, ca. 250 Millionen Euro.
Noch höher ist das Gesamtvolumen von Projekten, die das Fraunhofer IPA buchstäblich ins Weltall fliegen lassen. Auf 600 Millionen Euro schätzt Gommel die Kosten zukünftiger Weltraumprojekte, an denen sein Team beteiligt sein könnte. Wie ist es zur Zusammenarbeit gekommen? Als eine Delegation der European Space Agency (ESA) vor wenigen Jahren den Campus der Universität Stuttgart besuchte, ging es eigentlich um die biologische Sauberkeit von Oberflächen. Das klassische Sterilisieren gehört eigentlich nicht zu den Fachgebieten des Abteilungsleiters Reinst- und Mikroproduktion. Doch ein Vortrag, den Gommel im Anschluss an den Besuch über das Reinigen filigraner Bauteile bei der ESA hielt, überzeugte die Raumfahrtagentur. Das Ergebnis: Sein Institut ist heute Partner von ESA und NASA, wenn es darum geht, Reinräume zu entwickeln und Proben vom Mars blitzblank auf den Boden zu bringen.
Was kann nach dem All noch kommen? »Wir expandieren, machen Labore trockenraumfähig, nehmen Millionen in die Hand.« Die Augen des Physikers leuchten – was nicht nur an den guten Zahlen seines Instituts liegen könnte. Sondern auch am nächsten Tagesordnungspunkt: Auf seinem Motorrad macht sich Udo Gommel auf den Heimweg, durch die klare, regennasse Luft.
Dr.-Ing. Udo Gommel leitet die Abteilung Reinst- und Mikroproduktion am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart. Wer ihn einen Tag begleitet, macht überraschende Erfahrungen in Sachen Sauberkeit und Schlüsseltechnologien – und sieht Kreditkarten in einem völlig neuen Licht.
Dr. Shanshan Gu-Stoppel
»Wenn wir Schritt für Schritt in die Zukunft gehen, kann uns alles gelingen!«
Dr. Shanshan Gu-Stoppel ist für den Bereich Optische Systeme am Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT in Itzehoe zuständig, wo sie an MEMS-Bauelementen forscht. Die winzigen Bauelemente verarbeiten die mechanischen und elektronischen Strukturen in Mikrochips. Sie können in Themenfeldern wie Virtual Reality und 3D-Druck eingesetzt werden. Im Interview erzählt sie, womit sie Kunden begeistert, wie Fraunhofer autonomes Fahren vorantreibt – und warum sich ihr Sohn für einen Kran hält.
Die Vorstellungen, die wir uns von der Zukunft machen, sind so vielfältig und individuell wie die Menschen selbst. Wie klingt Ihre ganz persönliche Zukunftsmusik?
Mein Bild von Zukunft bezieht sich immer auf mein eigenes Forschen und Handeln. Früher wollte ich beispielsweise eine Komponente für das Handy entwickeln, die Projektionen an die Wand wirft. So sah mein Bild von übermorgen aus! Und was geschah? Die Zukunftsvision wurde durch Augmented Reality von der Realität überholt. Seitdem weiß ich, dass es nicht nur darum geht, eine Vision zu haben, sondern auch darum, sie schnell und engagiert voranzubringen. Das ist genau der Grund, aus dem Fraunhofer für Kunden so attraktiv ist.
Welche Produkte begeistern Ihre Kunden gegenwärtig?
Ein Beispiel: Der 3D-Druck ist im Alltag angekommen. Ob in der industriellen Produktion, der Raumfahrt oder Medizintechnik – die Ergebnisse sind extrem präzise. Wir können heute Knochenimplantate nicht nur passgenau herstellen, sondern so behandeln, dass sie das Anwachsen von knochenbildenden Zellen an der Oberfläche unterstützen. Aber um dem 3D-Druck eine noch höhere Produktionsgeschwindigkeit und Kostenreduktion zu erlauben, kommen unsere MEMS-Komponenten ins Spiel. Um das zu erreichen, möchten Hersteller eng mit uns zusammenarbeiten.
Klingt nach Medizin der Zukunft.
Aber sie findet schon heute statt! Das ist Fraunhofer: Wir identifizieren Zukunftsthemen, liefern exzellente Ergebnisse und setzen sie mit Unternehmen um. Mein Spezialgebiet sind dabei MEMS-Spiegel. Unter MEMS verstehen wir winzige Bauelemente, also Mikrosysteme, die mechanische und elektrische Informationen verarbeiten können. MEMS-Spiegel werden z. B. in LIDAR-Systemen beim autonomen Fahren genutzt. LIDAR steht für »light detection and ranging«, eine Methode zur optischen Abstandsmessung. Sie funktioniert wie ein Radar, nur mit Laserstrahlen.
LIDAR-Sensoren messen also Entfernungen?
Ja, aber ich würde nicht von Sensoren sprechen. LIDAR ist ein System. Deshalb arbeiten auch viele Institute an den Komponenten. Das autonome Fahren ist ein Zukunftsthema, das viele Erwartungen weckt, die wir bei Fraunhofer erfüllen werden. Was uns dabei antreibt, das ist die wissenschaftliche Herausforderung. Dieser Funke ist sogar auf meinen Sohn übergesprungen. Neulich hat er gesagt: »Ich bin ein Kran mit einem magnetischen Arm.« Wir haben ihm gezeigt, dass ein Magnet nicht an seinem Arm haftet. Seine Erkenntnis war, dass er doch nur ein Kran ohne Magnet ist … Ein Forschergeist mit Zukunft!
Auf der weltweit führenden Messe für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Photonik präsentiert das Fraunhofer ISIT unter dem Thema Mikro-Aktuatoren für optische Anwendungen aktuelle Forschungsschwerpunkte
Dr. Shanshan Gu-Stoppel leitet die Gruppe Optische Systeme des Geschäftsfelds MEMS-Anwendungen am Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT in Itzehoe. Zu ihrem Fachgebiet gehören Mikro-Spiegel und Mikro-Scanner-Systeme für Endverbraucher (z. B. Brillen für Augmented und Virtual Reality) oder für den Automobilmarkt (z. B. LIDAR-Systeme für das autonome Fahren).
Dr. rer. nat. Dirk Hecker
»In der Zukunft wird KI für uns so selbstverständlich sein wie Strom!«
Dr. Dirk Hecker ist stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin. Im Interview spricht er über Neuronale Netze, Roboter-Fußball und das Abstraktionsvermögen seiner Tochter.
Wie würden Sie Künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen mit einfachen Worten erklären?
KI befähigt Maschinen, Aufgaben intelligent zu lösen. Eine Schlüsseltechnologie der KI ist das maschinelle Lernen – eine Technik, mit der Computer Zusammenhänge und Muster aus Daten lernen können. Ihren gegenwärtigen Aufschwung verdankt die KI tiefen Neuronalen Netzen, die aus sehr großen Datenmengen – Big Data – lernen. In den vergangenen Jahren konnten mit diesen Algorithmen große Erfolge erzielt werden..
Das heißt, KI hängt von diesen Daten ab, von deren Menge und Qualität?
Genauso ist es. Wenn ich meiner 3-jährigen Tochter drei sehr vereinfachte Darstellungen einer Katze zeige, ist sie sofort in der Lage, eine Katze auf der Straße zu erkennen und sie auch so zu benennen. Sie braucht dazu also nur sehr wenige Trainingsbeispiele. Mit diesem Abstraktionsvermögen ist der Mensch der Maschine noch weit überlegen. Wenn es aber darum geht, Muster aus sehr großen und unterschiedlichen Datenquellen zu erkennen, kann eine KI dem Menschen mühsame Arbeit abnehmen. Ich sehe KI vor allem als Wegbegleiter des Menschen in einer sich ständig verändernden, dynamischen Welt, in der Informationen strukturiert werden müssen. Wir müssen jedoch stets unsere Entscheidungshoheit darüber behalten, wo und wie wir KI einsetzen wollen. Autonomie und Kontrolle sind der Schlüssel zu einer menschenorientierten KI, denn zukünftig wird sie für uns so selbstverständlich sein wie Strom.
Sie haben Ihre Institutserfolge bereits angesprochen, aber laut Tec Report 2019 des Technologieverbands VDE kommen heute 60 Prozent aller weltweiten Patentanmeldungen für KI aus den USA.
Warum schauen wir immer zuerst ins Silicon Valley? Unsere eigene Leistung wird zu wenig gewürdigt! Deutschland ist Weltmeister im Roboter-Fußball! Darüber hört und liest man kaum etwas. Wenn wir uns KI-Publikationen ansehen, kommen die meisten aus Europa. Wir arbeiten bei Fraunhofer intensiv daran, die KI-Forschung hierzulande weiter zu stärken und die Technologie schnell in Anwendung zu bringen. Das ist unsere Stärke.
Dr. rer. nat. Dirk Hecker ist neben seiner Tätigkeit als stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin Geschäftsführer der Fraunhofer-Allianz Big Data und Künstliche Intelligenz, des größten Zusammenschlusses von Fraunhofer-Instituten überhaupt.
Dr. Florian Herrmann
WHAT’S NEXT, FLORIAN HERRMANN? - WIE FRAUNHOFER INTELLIGENZ AUF DIE STRASSE BRINGT
Wenn Florian Herrmann morgens mit einem Plug-in-Hybrid ins Parkhaus des Fraunhofer-Institutszentrums Stuttgart fährt, ist er bereits Teil eines von ihm mit aufgesetzten Experiments. Zügig lenkt er den Wagen in das Forschungs-Parkhaus des Fraunhofer IAO, mit 30 Ladestationen für die Elektrofahrzeuge des hauseigenen Fuhrparks zukunftssicher ausgerüstet. »Unser Micro Smart Grid ist ein lebendiges Labor«, erklärt der 34-jährige Wissenschaftler. »Hier untersuchen wir, was für Ladestrukturen die Mobilität der Zukunft braucht. Den Fahrstrom erzeugen wir übrigens aus einer eigenen Photovoltaikanlage, hinzu kommen weitere Komponenten und Systeme wie Pufferbatterien oder ein LOHC-Speicher.« LOHC – »Liquid Organic Hydrogen Carrier« – gilt als »Superspeicher« für Energie; seine Anwender und Entwickler leisten derzeit Pionierarbeit wenn es darum geht, die Sektoren Mobilität und Energie intelligent miteinander zu verknüpfen. Die Ergebnisse werden – typisch für Fraunhofer – direkt in die Anwendung gebracht. »Wir beraten Kunden wie die Flughafen München GmbH oder die Stadt Stuttgart bei der Integration von nachhaltigen Mobilitäts- und Energiekonzepten.« Herrmann weiß um die Relevanz einer funktionierenden E-Infrastruktur in Deutschland: Selbst moderne Parkgaragen sind oft noch nicht dafür ausgelegt, Elektrofahrzeuge entsprechend zu laden. »Für unsere Auftraggeber untersuchen wir das Mobilitätsverhalten vor Ort. Muss gleichzeitig geladen werden? In welchem Maß? Dann entwickeln wir Szenarien, in denen das auch funktioniert.«
Doch Florian Herrmann hat nicht nur das Laden im Blick. Als Innovationsforscher beschäftigt er sich übergreifend mit den Auswirkungen neuer Antriebs- und Mobilitätskonzepte. Zuletzt sorgte eine von ihm mitveröffentlichte Studie zu Beschäftigungsauswirkungen, die auf Initiative der IG Metall in Kooperation mit u. a. VW, Daimler und BMW entstand, in Medien wie FAZ, SZ und SPIEGEL für Schlagzeilen. Sie prognostiziert, dass in der Herstellung von Antriebssträngen durch den Umstieg auf Elektromobilität bis zum Jahr 2030 in Deutschland rund 75 000 Arbeitsplätze wegfallen könnten, Produktivitätssteigerungen inklusive. Der Grund: Die Fertigung von E-Autos ist weit weniger aufwendig; sie haben weniger Teile, keinen Auspuff, keinen Tank und in vielen Fällen nur noch sehr einfache Übersetzungsgetriebe. Und die großen Batteriehersteller sitzen in Asien. »Auslöser für Angst und Panik sollte diese Zahl aber nicht sein«, so der Forscher heute. »Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind gefordert, sich dieser Transformation zu stellen und sie sinnvoll zu gestalten.«
Florian Herrmann betritt nun den oberirdischen Teil des Zentrums für Virtuelles Engineering ZVE. Licht ist ein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes, das 2012 nach Plänen des Stararchitekten Ben van Berkel auf dem Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart gebaut wurde. Große Tafeln mit farbigen Post-it-Zetteln lassen Rückschlüsse auf Workshops, Brainstormings und diverse weitere kreative Arten der Ideenfindung zu. »Die Übermorgenmacher« steht auf einem Aufkleber an einer übergroßen Pflanze. Herrmann, der in Konstanz und Karlsruhe studierte und in Stuttgart promovierte, begann seine Karriere im Jahr 2011 am Fraunhofer IAO. Erführt uns am »Immersive Engineering Lab« vorbei zu einem aufgeräumten Arbeitsplatz, auf dem eine weitere Studie liegt. »Gemeinsam mit dem
›Senseable City Lab‹ des renommierten Massachusetts Institute of Technology MIT haben wir das Taxisystem in New York auf die Möglichkeiten des Einsatzes neuer Mobilitätskonzepte und Geschäftsmodelle untersucht. Eine Auswertung von 170 Millionen Taxifahrten unserer amerikanischen Forscherkollegen ergab: Wären die Fahrgäste bereit, im Schnitt fünf Minuten ein Taxi zu warten, könnten sie sich fast alle Fahrten teilen. Hinzu kommen weitere Potenziale durch neue Services und Dienstleistungen, wie bspw. durch den Einsatz kontextsensitiver Werbung. Für die Stadt bedeutet dies, ganz konkret wesentlich weniger Verkehr und neue Umsatzpotenziale durch innovative Dienstleistungen!« Zukunftsfragen werden am Fraunhofer IAO in der Tradition des Instituts-Mitgründers und ehemaligen Fraunhofer-Präsidenten Prof. Hans-Jörg Bullingers analysiert. In seinem Sinne wirkt der Mobilitätsforscher Florian Herrmann an der Schnittstelle zwischen dem, was technisch möglich ist, und der Frage, wie dies vom Menschen angenommen wird. So unterstützte er und eine Vielzahl an Forschenden das Unternehmen Audi im Rahmen der breit angelegten Studie »Die 25. Stunde«, bei der es um optimale Bedingungen für Fahrgäste im Innenraum eines autonomen Fahrzeugs geht. Auch der Bericht »Enabling the Value of Time« setzt sich mit der Innenraumgestaltung automatisierter Mobilitätskonzepte auseinander. »Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie erarbeiten wir Möglichkeiten, die Zeit für autonom Fahrende so angenehm wie möglich zu gestalten«, erläutert er. Während in einigen Kulturkreisen Gaming oder Entspannung erwünscht seien, empfänden die Deutschen Möglichkeiten für die Privatkommunikation als besonders attraktiv. Im durchgeführten Ländervergleich würden die Deutschen sogar am meisten für eine zusätzliche frei verfügbare Stunde bezahlen.
Zur Mittagszeit kreisen Herrmanns Gedanken schon wieder um die Elektromobilität. In Deutschland gelten bereits vergünstigte Steuersätze für batteriebetriebene Dienstwagen; VW, immerhin der größte Automobilhersteller der Welt, will ab 2020 allein in Zwickau 100 000 Stromer pro Jahr montieren. Werden wir jetzt alle Hochvolt-Spezialisten? »Um Städte und die Umwelt lebenswert zu gestalten, sollte Elektromobilität nicht das einzige Mittel sein.« Sein Sakko hat Florian Herrmann längst ausgezogen. Skepsis tritt in sein Gesicht: Gewiss sei elektrifiziertes Fahren bei Autos, die kürzere aber wiederkehrende Strecken zurücklegen, sinnvoll. Bei längeren Distanzen in schweren Limousinen lohnen sich diese indes nicht in jedem Fall. Denn je größer die Reichweite eines Autos, desto größer seine Batterie. Und je größer die Batterie, desto CO2-intensiver ihre Herstellung. Das Elektroauto, das ganze Familien problemlos von Norddeutschland nach Italien bringt, das schnell fährt und bezahlbar ist, gibt es also gar nicht? »Ganz genau! Anstatt lediglich eine Antriebsart durch die andere zu ersetzen, brauchen wir intermodale Konzepte, bei denen sich Antriebsarten und Mobilitätskonzepte ergänzen.«
Am Nachmittag erkundet Herrmann im »Mobility Innovation Lab« des Fraunhofer IAO mit Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Design, Physik, Maschinenbau und Psychologie die Möglichkeiten der Interaktion zwischen Mensch und Auto. Von einer Mitarbeiterin lässt er sich den Stand eines Projekts zur Innenraum-Konfiguration selbstfahrender Autos erläutern. Gegenüber parkt ein Elektroflitzer, dessen Scheinwerfer wie Bewegungsmelder auf seine Nähe reagieren. »Das nachschauende Licht emotionalisiert die Botschaft, dass das Auto einen Passanten erkannt hat und stehen bleiben wird. Dieses deutliche Signal kann Verkehrsteilnehmern gewisse Ängste vor automatisierten Fahrzeugen nehmen – zum Beispiel vor Robotaxis«, erklärt der Forscher. Wann wird das vollautomatisierte Fahren kommen? »Bestimmt nicht morgen. Der Umstieg hin zu neuen Mobilitätsangeboten ist generell kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf.« Als begeisterter Marathonläufer kennt sich Herrmann mit weiten Distanzen aus. »Man darf nicht nachlassen. Niemand kann genau sagen, was die Zukunft bringt. Aber wir können sie aktiv gestalten – mit einem Verständnis von Forschung, das nicht nur auf das Machbare setzt. Wichtig ist, dass Technik vom Menschen angenommen wird – weil sie das Leben erleichtert, weil sie sinnvoll ist.« Am Ende des Tages wechselt Florian Herrmann vom Hemd zur Sportkleidung, bevor er das Institut verlässt und zu einem langen Lauf am Bärensee verschwindet.
Dr. Florian Herrmann leitet den Forschungsbereich Mobilitäts- und Innovationssysteme am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart. Wer ihn einen Tag lang begleitet, versteht, warum die Umstellung auf intelligente Fortbewegungskonzepte ein Langstreckenlauf ist – und, was man dabei von Joseph von Fraunhofer lernen kann.
Dipl.-Ing. Oliver Hermanns

»Ich freue mich auf die Umsetzung neuer Konzepte zur Verbesserung der Mobilität – bei geringerem Risiko im Straßenverkehr, niedrigeren Emissionen und mehr Zeit für das Wesentliche im Leben. Dabei unterstützen wir mit unserer Software. Wir haben es geschafft, unsere Echtzeit-Simulationen zur Auslegung und Absicherung kilometerlanger Bordnetze und Schlauchsysteme von Fahrzeugen in einer VR-Umgebung nutzbar zu machen und Teams aus unterschiedlichen Bereichen für eine neue Art des interdisziplinären Entwickelns am virtuellen Fahrzeug zusammenzubringen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es immer ein schönes Erlebnis bleibt, Menschen persönlich zu treffen und im Team zu arbeiten!«
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Hermanns war Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern. 2012 gründete er das Unternehmen fleXstructures GmbH, das mittlerweile auf rund 30 Mitarbeitende angewachsen ist. 2019 verlieh der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing den Innovationspreis des Landes an fleXstructures und das Fraunhofer ITWM in der Kategorie »Kooperation«.
Steffen Hess
WHAT’S NEXT, STEFFEN HESS: ZUKUNFT, QUERFELDEIN
Steffen Hess leitet am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern das Forschungsprogramm »Smart Rural Areas«, das sich mit der Digitalisierung ländlicher Regionen beschäftigt. Der Programm-Manager fordert einen neuen Fokus: Neben technischen Fragen zu Breitbandausbau und 4G auf dem Land müssten passgenauere digitale Anwendungen her – übergreifende Plattformen, die zukünftig die Lebensqualität gerade auch auf dem Land fördern. Wie das geht, zeigen die Projekte seines Instituts, die sich bisher mit der Entwicklung von digitalen Diensten in den Bereichen Mobilität, Arbeit, Nahversorgung, Verwaltung und Kommunikation befassen.
»Probieren Sie mal!« Steffen Hess steht in der Kaffeebar Marónoro in Mackenbach, einer kleinen Gemeinde in Rheinland-Pfalz. »Hervorragende Bohnen und Weltklassekaffee.« Der Projektleiter vom nahe gelegenen Fraunhofer IESE in Kaiserslautern freut sich über den Cappuccino an der Bar. Jörg Müller, Betreiber der kleinen Rösterei, schenkt noch etwas Milchschaum nach – und erzählt, dass er sich auf DorfFunk freut, eine von Wirtschaftsingenieur Hess mitentwickelte App zur Digitalisierung ländlicher Regionen, die jede Menge Leben in die 2 000-Seelen-Gemeinde bringen könnte. »DorfFunk ist eine digitale Plattform für Menschen auf dem Land, die ich schon von Orten aus der Nachbarschaft kenne. Hier macht man sich auf entlaufene Igel aufmerksam, verschenkt Apfelkuchen und beantwortet Fragen nach Bäckereien, die Spezialitätenkaffee haben. Das sind natürlich wir!«, freut sich Müller, dessen Laden von der Plattform profitieren dürfte. Von Steffen Hess lässt er sich nun zeigen, was heute auf DorfFunk los ist: Die am Fraunhofer IESE entwickelte App ist ein digitaler Raum für Interaktion, der wie eine freundliche Kombination aus Diensten wie Facebook, WhatsApp und dem Digitalangebot der fortschrittlichsten Großstadtrathäuser wirkt – inklusive der Möglichkeit zum Livechat mit dem Bürgermeister und seinem Team. »Ich werde die App auf jeden Fall benutzen. Dann lade ich Gäste ein, plausche mit Leuten aus der Nachbarschaft, informiere über Veranstaltungen – und weiß immer, wann bei uns etwas los ist«, erzählt Müller.
Passt Jörg Müllers Kaffeerösterei überhaupt hierher? »Typisch!« Der Thirtysomething Hess lacht. »Das ist unser Bild von Deutschland: abgehängte Provinzen und lebendige Metropolen. Dabei ist selbst hier, vorm Pfälzer Wald, jede Menge los. Und wo das nicht der Fall ist, da muss man etwas unternehmen!« Immerhin würden nur neun Prozent der deutschen Bevölkerung in Großstädten wohnen, führt Steffen Hess auf dem Weg von Mackenbach nach Kaiserslautern zu seinem Institut aus. Zwei Drittel aller Menschen in Deutschland würden in Städten mit weniger als 100 000 Einwohnern leben. Dennoch: In der Region ist die Landflucht Thema Nummer eins: »Wie wird mein Dorf aussehen, wenn die Bevölkerung immer älter wird? Werden dann noch junge Leute und Familien zu uns ziehen? Wie oft kommen Busse vorbei, wie viele Arztpraxen werden schließen, was für Läden noch aufmachen? Diese Fragen stellen wir uns in meiner Heimat.«
»Der ländliche Raum ist mehr als ein Sehnsuchtsort für gestresste Stadtromantiker«, erklärt Hess. »Er ist ein Markt und Wirtschaftsstandort. 60 Prozent aller Betriebe sitzen hierzulande in den ländlichen Regionen. Bei der Digitalisierung Schritt zu halten ist für sie ein entscheidender Faktor.« Die Rechnung sei einfach: Ohne Menschen auf dem Dorf keine Industrie auf dem Land. Wo lokale Zeitungsredaktionen schlössen und Gaststätten leer stünden, müsse den Bewohnern eine digitale Plattform für Informationen, Dienstleistungen und Austausch gegeben werden – eine Infrastruktur für Besiedlungen von bisweilen nur tausend Einwohnerinnen und Einwohnern auf zehn Quadratkilometern. Von denen schon heute nur ein Drittel einen Supermarkt zu Fuß erreichen kann.
Mit der DorfFunk-App als digitalem Dienst könnte sich das langsam ändern – und aus Landflucht Landlust werden. Vom damaligen Leiter des Forschungsbereichs »Embedded Systems« am Fraunhofer IESE erdacht und im Rahmen der CeBit 2015 an Ministerpräsidentin Malu Dreyer weitergetragen, stand in den vergangenen fünf Jahren ein Etat von fünf Millionen Euro bereit; Hauptfinanziers waren das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport, die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. und das Fraunhofer IESE selbst. Nach der Erprobung in zwei Modellregionen werden mittlerweile unter dem Dach der Forschungsinitiative »Smart Rural Areas« überall in Deutschland Apps wie DorfFunk etabliert – zuletzt in den Kreisen Lippe und Höxter in Nordrhein-Westfahlen, wo 30 000 Menschen die App nutzen können. Was kommt als Nächstes, Steffen Hess? »Bei unserem neuesten Projekt geht es um Landkreise in Deutschland, mit denen wir eine Plattform mit vielen Diensten der Daseinsvorsorge entwickeln«, erklärt der Software-Entwickler. Zehn Millionen Euro beträgt das Volumen dieses Ankerprojekts. Für den Menschen müsse die neue Plattform einfach gut benutzbar sein, so Hess – sie müsse aber auch als Geschäftsmodell funktionieren. »Alle arbeiten hier, weil sie gerne hier arbeiten. Weil sie sehen, dass sie anderen Menschen helfen. Zum Beispiel, weil sie Seniorinnen mittels DorfFunk Partner für den Sonntagsspaziergang vermitteln und somit deren Einsamkeit durchbrechen. Und weil sie die Möglichkeit haben, einfach mal zu machen.« »Testen Sie mal!« Wie auf Kommando ruft ein junger Informatiker den Namen einer noch geheimen Anwendung in den Raum. »Ist gerade fertig geworden.« Funktioniert sie dieses Mal? Der Wissenschaftler Steffen Hess kann es kaum erwarten, die neue Anwendung auszuprobieren. Neugier mischt sich in seinen Blick, aber auch eine Art genießerischer Vorfreude, fast wie bei dem Cappuccino in der Kaffeerösterei am heutigen Morgen in Mackenbach, einem kleinen Dörfchen in Rheinland-Pfalz.
Dr.-Ing. Anna Hilsmann
»Computer werden sehen lernen – und dabei Zusammenhänge und Strukturen erfassen, um Menschen bei ihren Tätigkeiten besser unterstützen zu können. Hier geht es darum, die Umgebung zu analysieren und die gewonnenen Informationen visuell zur Verfügung zu stellen. In einigen Bereichen erkennen Computer Muster bereits schneller und sicherer als der Mensch. Wir setzen diese Fortschritte durch KI verantwortungsbewusst ein und nutzen damit freiwerdende Ressourcen. So verbessern wir computergestützte Assistenzsysteme und machen medizinische Eingriffe sicherer. Auch Arbeitsplätze können durch automatische Umgebungsanalysen und AR-Visualisierungen sicherer und Arbeitsabläufe einfacher gestaltet werden.«
Dr.-Ing. Anna Hilsmann ist Gruppenleiterin Computer Vision und Grafik am Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI in Berlin. Für ihre Dissertation, in der es um fotorealistische, bildbasierte Animation und das Rendering komplexer Objekte geht, wurde die Informatikerin 2016 mit dem ARD/ZDF-Förderpreis »Frauen + Medientechnologie« ausgezeichnet.
Dipl.-Ing. Eckhard Hohwieler

»What’s next? Durch smarte mobile Devices, personalisierbare Assistenzsysteme oder trainierbare Systeme Künstlicher Intelligenz werten wir das Image von Industriearbeit auf und machen sie für junge Menschen attraktiver. Neue Technologien werden das Arbeiten in der Industrie nachhaltig positiv verändern. Die entsprechende Digitalisierung in der Industrie wird deren Flexibilität und Effizienz auf allen Ebenen und in allen Prozessen steigern. Und die damit einhergehenden Innovationen werden die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte Deutschland und Europa stärken.«
Dipl.-Ing. Eckhard Hohwieler ist Abteilungsleiter Produktionsmaschinen und Anlagenmanagement am Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK in Berlin. Die Entwicklungen seines Teams zeigen die Machbarkeit und Potenziale neuester Technologien in der Industrie 4.0 auf.
Anandi Iyer

»Zukünftig werden Deutschland und Indien stärker zusammenrücken!
Für Forschung und Wirtschaft ist Fraunhofer India dabei ein Türöffner: Mit über 30 Instituten unterstützen wir Projekte rund um Themen wie Smart Cities und erneuerbare Energien. Dass wir hier wie eine Antenne funktionieren, macht mich wirklich stolz. Was ich mir persönlich für die Zukunft vorgenommen habe? Ordnungsliebe und Respekt an meine Kinder weitergeben. Den Sinn für Ordnung schätze ich an den Deutschen besonders. Respekt ist die Basis, wenn man in Indien Geschäfte machen möchte. Beides zusammen ergibt den perfekten Mix!«
Anandi Iyer studierte in Delhi Naturwissenschaften und Psychologie, ehe sie in Großbritannien den Master of Business Administration machte. Zurzeit schreibt sie ihre Doktorarbeit an der Uni Leipzig/ Fraunhofer IMW. Seit 2008 leitet sie das Fraunhofer-Büro in Bangalore, das sich als Knowledge Center/Antenne für Indien, Sri Lanka, Bhutan und Nepal versteht.
Dipl.Ing. Kati Kebbel
»Unsere Arbeit rettet Leben!«
Als Hauptabteilungsleiterin GMP Zell- und Gentherapie am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig setzt die Diplom-Ingenieurin für Biotechnologie Kati Kebbel auf Qualität – und ist davon überzeugt: »Wir helfen dabei, Krankheiten zu heilen!«
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit mit den drei Buchstaben GMP?
GMP steht für Good Manufacturing Practice. Darunter verstehen wir die kontinuierliche Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln. Konkret heißt das, dass wir Arzneimittel für neuartige Therapien, sogenannte ATMPs, herstellen. Das unterliegt strengsten Qualitätsstandards und ist mit einem sehr hohen Dokumentationsaufwand verbunden. Ich liebe strukturiertes Arbeiten, bin kritisch und analysiere gern. Meine pharmazeutischen Funktionen als Leiterin der Qualitätskontrolle und als Sachkundige Person sind mir daher wie auf den Leib geschneidert.
Das klingt nach einem Höchstmaß an Verantwortung.
Das stimmt. In meiner Funktion als Sachkundige Person prüfe ich jede Produktionscharge genauestens auf Qualität, Plausibilität und Konsistenz, bevor sie an unsere Auftraggeber abgegeben wird. Außerdem rettet unsere Arbeit Leben. Das spornt zusätzlich an. Schließlich überführen wir neue Arzneimittel in die klinische Anwendung. Das ist ein wichtiger Schritt für neue innovative Therapien. Und das in einem der wichtigsten Bereiche: Krebsforschung. Erst Mitte September war das Fraunhofer IZI Gastgeber der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gentherapie. Das Motto des Thementags war »CAR-T cells and beyond«. Die Herstellung der genmodifizierten T-Zellen mit chimärischem Antigen-Rezeptor, kurz CAR-T-Zellen, ist eine unserer Erfolgsgeschichten: ein Immuntherapeutikum, für das wir im Auftrag von Novartis die Herstellung und Qualitätskontrolle für die klinische Anwendung durchführen. Die Therapie nutzt T-Zellen des Patienten, um spezielle Formen der Leukämie zu bekämpfen. Wir arbeiten mit unseren Projektpartnern aber auch an anderen hoffnungsvollen Therapien. Für mich bedeutet unsere Arbeit, neuen Produkten Zugang zur Klinik zu ermöglichen – und damit Patienten die Möglichkeit zur Nutzung neuer Therapieformen zu eröffnen.
Dipl.-Ing. Kati Kebbel leitet die Hauptabteilung GMP Zell- und Gentherapie am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI zusammen mit Dr. Gerno Schmiedeknecht. Die strategisch wichtige Hauptabteilung ist auf die Prozessentwicklung, Validierung, Herstellung und Qualitätsprüfung von klinischen Prüfpräparaten auf dem Gebiet der ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) spezialisiert.
Dr. Tina Klages
»Wissen teilen ist der Motor zukünftiger Innovationen!«
Dr. Tina Klages arbeitet am Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB in Stuttgart. Die Leiterin des Teams „Open Science“ versteht sich als Forscherin aber auch als Brokerin, die Akteure zu diesen Themen zusammenbringt. Im Interview erklärt sie, warum Offenheit und Partizipation in Forschungs- und Innovationsprozessen in der Wissensgesellschaft von morgen unverzichtbar sind.
Was bedeutet Open Science für Sie persönlich?
Ich möchte die Wissenschaft öffnen wo dies möglich ist. Dies bezieht sich einerseits auf die Nachnutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, andererseits auf die Integration von Stakeholdern um weitere Perspektiven in den Forschungs- und Innovationsprozess einbringen zu können. Mit diesem Fokus vertrete ich neben der Bearbeitung von Forschungsprojekten die Fraunhofer-Interessen in nationalen und internationalen Gremien und berate bei der strategischen Ausrichtung zu Open Science.
Haben Sie ein konkretes Projektbeispiel?
Zurzeit begleite ich das Projekt »Citizen Sensor – Umweltanalytik für jedermann«. Hier arbeiten das FabLab München e. V., eine offene Bürgerwerkstatt, die Fraunhofer EMFT und das Fraunhofer IMW zusammen. Das Ziel: ein Messverfahren für Nitrat für den Garten-Hausgebrauch in Kooperation zwischen Wissenschaftlern und „Makern“ (Tüftlern) zu entwickeln. Dieses und andere Citizen Science Projekte bei Fraunhofer zeigen, dass die Kooperationsform nicht nur einen deutlichen Mehrwert hat, sondern die Fraunhofer-Gesellschaft dadurch ihrem Auftrag der Forschung mit und für die Gesellschaft sogar wortwörtlich nachkommt.
Sie versuchen Maker-Bewegung und institutionalisierte Forschung zusammenzubringen. Was wollen die »Maker« überhaupt?
Es sind „Tüftler“ verschiedener Disziplinen, die im Sinne der Do-it-yourself-Bewegung unter anderem in FabLabs oder Maker Spaces zusammenkommen um gemeinsam an Problemstellungen zu arbeiten und die Ergebnisse in der Regel der Allgemeinheit offen zur Verfügung stellen.
Ich sehe hier einen spannenden Aspekt: Einen partizipativen Ansatz, der Forschung sowohl bereichert als auch bürgernah macht. Er könnte in Zukunft einer von vielen Erfolgsfaktoren sein. Vernetzung und Automatisierung werden uns mehr systemisches Denken abverlangen. Es geht nicht nur um die Entwicklung neuer Technologien, sondern auch um Akzeptanz, Befähigung und Teilhabe: Wir müssen daher Forschungs- und Innovationsprozesse neu denken und bereit sein, mehr Akteursgruppen zu integrieren um gegenseitiges Lernen zu ermöglichen und dadurch letztlich aktuelle Herausforderungen gemeinsam zu lösen.
Dr. Tina Klages ist seit 2010 als Expertin für Open Science und die Digitalisierung der Wissenschaft bei der Fraunhofer-Gesellschaft tätig. Im Januar 2019 hat sie die Teamleitung im Bereich Open Science im Competence Center Research Services & Open Science am Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB in Stuttgart übernommen. Ihre Themen umfassen Open Science und den Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, sowie die Integration neuer Akteure in Forschungs- und Innovationsprozesse als auch Ansätze neuer Verwertungspfade.
Dr. Alpha Tom Kodamullil
»Ich möchte eine gute Forscherin sein und eine erfolgreiche Unternehmerin«
Dr. Alpha Tom Kodamullil ist Bioinformatikerin am Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI in Sankt Augustin. Warum ihre Arbeit in Zukunft die Vorhersage und Behandlung von Krankheiten wie Alzheimer verbessern könnte, erklärt sie im Interview.
Sie arbeiten im Bereich Bioinformatik. Wie spielen dabei Erkenntnisse aus Biologie und Medizin mit Informatik zusammen?
Wir nutzen Verfahren der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens, um neue Erkenntnisse über die Entstehung und Bekämpfung von Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson zu gewinnen. Dazu bringen wir Klinikdaten von Patienten und wissenschaftliche Publikationen zusammen, um bis in die Molekülebene biochemische Prozesse zu analysieren, die mögliche Auslöser für Krankheiten sind.
Für Ihre Doktorarbeit haben Sie alle verfügbaren Daten über Alzheimer gesammelt und ausgewertet. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Wir bringen die Daten in eine bestimmte Struktur und sorgen so dafür, dass sie vom Computer gelesen und analysiert werden können. Leistungsfähige Rechner und spezielle Algorithmen suchen dann nach Mustern und Querverbindungen. So konnten wir im menschlichen Organismus 126 Wirkmechanismen nachweisen, die einen Zusammenhang mit Alzheimer zeigen. Die Pharmaindustrie erforscht derzeit nur vier davon.
Ihre Arbeit liefert also Ansätze, die bedeuten könnten, dass es irgendwann individualisierte Medikamente für Alzheimer-Erkrankte geben wird. Haben Sie selbst damit gerechnet?
Man weiß vorher nie genau, wohin sich Forschung entwickelt. Aber es zeigt sich immer wieder: Wer mutig forscht und neugierig bleibt, der wird auch relevante Entdeckungen machen!
War das auch Ihre Motivation dafür, ein Start-up in Kerala zu gründen?
Ja, das Bioinformatik-Start-up »Causality Biomodels« baut auf Erkenntnissen meiner Doktorarbeit auf. Aber ich arbeite weiter bei Fraunhofer SCAI. Das kann ich am besten in Englisch sagen: I want to excel! Ich möchte eine gute Forscherin sein und eine erfolgreiche Unternehmerin – ganz nach dem Vorbild Joseph von Fraunhofers
Dr. Jutta Kühn
»Bei Fraunhofer entstehen neue Technologien, die unsere Zukunft revolutionieren! Die Weiterentwicklung von Halbleitertechnologien am Fraunhofer IAF ist ein gutes Beispiel dafür, was unsere Welt prägen und verändern wird – egal, ob es um sichere Kommunikation, autonome Mobilität oder den Einsatz mobiler Roboter in Kollaboration mit dem Menschen geht. Im Zusammenhang mit 5G sind es unsere Entwicklungen, die Leistungen erhöhen und ein großes Potenzial zur Energie- und CO2-Einsparung in sich tragen. Mit meinem Beitrag hierzu kann ich die digitale Welt mitgestalten und so auch für meine Kinder eine lebenswerte und sichere Zukunft schaffen.«
Dr. Jutta Kühn promovierte 2010 am Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF zu innovativen Schaltungstechniken zur Optimierung des Wirkungsgrads Galliumnitrid-basierter Hochleistungsverstärker. Hierfür wurde sie mit dem renommierten Amelia-Earhart Förderpreis ausgezeichnet. Derzeit ist Kühn stellvertretende Institutsleiterin, Bereichsleiterin der wissenschaftlichen Abteilung sowie Leiterin der Abteilung Mikroelektronik – als Führungskraft in Teilzeit.
Holger Kunze
»Die Zukunft wird leicht, leise und leistungsstark – dank Smart Materials!«
Büroklammern mit eingebautem Gedächtnis, Rollos in Form von Blüten, die wie Energiespeicher funktionieren: Die Zukunft gehört klugen Gegenständen. Holger Kunze, Hauptabteilungsleiter Mechatronik am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, entwickelt sie. Er weiß: Smart Materials machen Gegenstände leichter, kleiner – und verständlicher.
Smart Materials mit Gedächtnis: Das klingt nach Zauberei. Wie hat man sich das vorzustellen?
Denken Sie an eine Büroklammer aus Formgedächtnisdraht. Hier ist der Name Programm: Die speziellen Metalle können in zwei Kristallstrukturen existieren, sich also eine zweite Form merken Die Büroklammer kann ich verbiegen. Wenn ich das Material mit einem Fön erwärme, erinnert es sich an seine ursprüngliche Form, geht dahin zurück und übt bei diesem Prozess Kraft aus. Ein zwei Millimeter starker Formgedächtnisdraht kann über 100 Kilogramm heben. Dabei schaltet er mehr als 100 000 Mal zwischen zwei Zuständen um, ohne zu ermüden. Bezogen auf das Volumen sind sie die stärksten Antriebe, die wir kennen, leistungsfähiger als Elektro- oder Hydraulikmotoren.
Wo wird die Technologie in Anwendung gebracht?
Bei Sonnenrollos an Gebäuden ergeben sich hier neue Gestaltungsmöglichkeiten für Lamellen, die z. B. die Form von Blüten haben können. Die flexiblen Entwürfe passen sich an wechselnde Bedingungen an und funktionieren energieautark, werden also nur von der Sonne gespeist. Wir haben viele Anwendungen, die kurz davor stehen, kommerzialisiert zu werden. Zum Beispiel ein Bewegungskissen für Säuglinge mit angeborener Schädeldeformation, das eine dauerhafte Belastungsposition des Kopfes vermeiden hilft.
Ein motivierendes Beispiel dafür, Smart Materials weiter leidenschaftlich voranzutreiben.
Absolut. Aber ich möchte vor allem dazu beitragen, dass technische Dinge für jeden versteh- und bedienbar sind. Das ist unser Anspruch an Smart Materials: Funktionalität erhöhen, Komplexität reduzieren.
Holger Kunze ist Hauptabteilungsleiter Mechatronik am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden. Er begann seine Laufbahn als Forschungsingenieur bei VW; mit seinem Wissen über Werkstoffe in der Automobilindustrie hat er ab 2002 den Aufbau der Abteilung Smart Materials/Adaptronik am Fraunhofer IWU begleitet. Heute koordiniert er das Innovationsnetzwerk smart3. Mit einem Projektvolumen von über 70 Millionen Euro entwickelt die Initiative auf der Basis von Smart Materials innovative Produkte für verschiedenste Bereiche – von Gesundheit bis Klimaschutz, von Lifestyle bis Mobilität. Auch bei »Jugend forscht« war das Fraunhofer IWU 2019 höchst präsent – als Bundespateninstitut für Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb.
Dr. Nadine Lang
WHAT’S NEXT, NADINE LANG - DIE ZUKUNFT TRÄGT COMPUTER
Vor der großen Glasfront am Ende des Gangs ist ein junger Mann auf einem Laufband zu sehen. Er trägt ein schwarzes Shirt, an dessen Vorderseite eine Leuchtdiode blinkt. Dr. Nadine Lang und eine weitere Mitarbeiterin aus ihrem Team kontrollieren Biosignale wie Puls oder Herzrate des Läufers, die auf ihren Laptop übertragen werden. Die Forscherin befasst sich mit dem Thema »Affective Sensing«. Es geht darum, eine Software zu entwickeln, die nicht nur Vitalfunktionen erfassen, sondern auch bestimmte Zustände des Menschen erkennen und interpretieren kann: Stress oder Überforderung etwa. Die 36-jährige Projektleiterin hat schon während ihres Physikstudiums einen Medizin-Schwerpunkt gesetzt. Man sieht der Wissenschaftlerin an, dass Gesundheit ihr Thema ist. Und man kann sich von ihrer Fitness überzeugen, wenn sie über die langen Gänge und Treppenhäuser zurück an ihren Schreibtisch spurtet.
Hier hat Langs Arbeitstag wie üblich sehr früh angefangen. Und das erste Projekt, von dem sie erzählt, lässt prompt aufhorchen: »Wir arbeiten gerade für die NBA. Als unabhängiges Forschungsinstitut validieren wir handelsübliche Wearables, also Computer, die am Oberkörper getragen werden«, erklärt die Forscherin. Auch in diesem Moment ist ihre Leidenschaft für Sport und Gesundheit greifbar. Die NBA, die stärkste und populärste Basketball-Profiliga der Welt, ist mit Blick auf Wearables aus gutem Grund auf das Fraunhofer IIS zugekommen. Man versteht darunter kleine vernetzte Miniaturrechner wie beispielsweise Smartwatches, die den Puls messen. Die Wearables aber, die Nadine Lang mit ihrem Team entwickelt, können viel mehr: Das FitnessSHIRT mit integrierter Sensorik im Brustbereich erfasst EKG-Daten und Atmung. In seiner Weiterentwicklung als CardioTEXTIL hilft ein mobiles Mehrkanal-EKG dabei, Veränderungen der Herzkranzgefäße frühzeitig zu erkennen und damit Herzerkrankungen wirksam vorzubeugen.
Als sie 2015 ans Fraunhofer IIS kam, arbeiteten die Kolleginnen und Kollegen an einem Sensor, der Laktat im Schweiß messen sollte. Der Forschungshintergrund: Über eine Blutprobe am Ohr wird der Belastungszustand z. B. bei Profifußballern anhand des Laktatspiegels im Blut regelmäßig kontrolliert. Ein Aufwand, den Freizeitsportler oder Jugendsportmannschaften nicht betreiben können. Deshalb habe man zusammen mit Sportwissenschaftlern den Bedarf einer solchen Belastungsmessung identifiziert, aber auch festgestellt, dass man nach anderen aussagekräftigen Parametern dafür suchen müsse. »Wir haben herausgefunden, dass Ammoniak im Schweiß dem Indikator Laktat im Blut ähnlich ist.« Wenn die Kohlenhydrate im Körper aufgebraucht sind, verbrennt er Eiweiße. Dabei entsteht Ammoniak, das als Gift über den Schweiß vom Körper ausgeschieden wird – und messbar ist. »Zusammen mit unserem Schwesterinstitut, dem Fraunhofer IISB, haben wir den Demonstrator ELECSA® entwickelt. Damit messen wir mobil den Ammoniakwert im Schweiß, übertragen die Daten in Echtzeit über Bluetooth und helfen so, Trainingseinheiten auf die individuelle Leistungsfähigkeit abzustimmen«, berichtet Lang, bevor sie noch kurz eine Information aus dem Labor gegenüber abfragt.
Denn auf ihrer Agenda steht heute die Weiterentwicklung dieser mobilen Sensorik, die Messdaten in medizinischer Qualität liefert. Einen wertvollen Beitrag kann der nichtinvasive ELECSA®-Sensor auch auf medizinischer Ebene leisten: Ein neues Projekt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung soll den Elektrolyt-Haushalt zu früh geborener Babys erfassen. »Die Frühchen müssten nicht mehr ständig gepikst werden, wenn ihnen Blut abzunehmen ist«, hofft die Biophysikerin. Zu ihren Aufgaben gehört auch, Partner in der Industrie zu finden, um die Entwicklungen ihrer Gruppe in Anwendung zu bringen. Beim CardioTEXTIL gibt es bereits einen Verwertungspartner, der es gemeinsam mit dem Fraunhofer IIS zu einem »medical grade wearable« machen will. »Wir werden unsere Sensorik vom Sport- und Lifestyle-Produkt in medizinische Anwendungen überführen.« Dabei denkt sie auch an die Möglichkeit eines effektiven Home-Monitorings zum Beispiel für ältere Menschen, die nur eingeschränkt mobil sind. Die Wissenschaftlerin ist überzeugt, dass sich durch ihre Arbeit hier gute Zukunftschancen ergeben.
Nadine Lang beantwortet noch schnell eine E-Mail und stimmt sich mit einer Kollegin über den weiteren Tagesablauf ab. Den Weg zur nächsten Teambesprechung nutzt sie für einen Kontrollblick aufs Handy. Das Meeting findet an diesem schönen Herbsttag unter einem Baum vor dem Institut statt. »Ich war schon als Kind am liebsten draußen!«, erklärt sie, während sie durch eine futuristisch anmutende Glasschleuse zum Treffpunkt eilt. Tempo und Struktur sind Langs Stärken, ihre Ziele sind ehrgeizig. Sie treffe ihre Entscheidungen nicht aus dem Bauch, sondern auf der Grundlage valider Argumente, sagt sie und erinnert an ihren universitären Hintergrund als Grundlagenforscherin. Heute nicht nur forschen und sich dabei dem Thema Gesundheit widmen zu können, sondern ganz nah an der Anwendung zu arbeiten, das mache den besonderen Fraunhofer-Reiz für sie aus. »Wir hören darauf, was die Leute haben wollen und was sie brauchen!« Darauf folgt für Nadine Lang eine Runde Sport: Denn Klettern, Wandern oder Radfahren sind für sie fast so wichtig wie die Wissenschaft – und der Wunsch, Wearable-Technologien zur Gesundheitsvorsorge weiter voranzutreiben.
Die promovierte Biophysikerin Dr. Nadine Lang arbeitet als Chief Scientist und Projektleiterin am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen. In der Abteilung Bildverarbeitung und Medizintechnik gehört ihr Team zur Gruppe Biosignalverarbeitung. Ihre Entwicklungen klingen nach Medizintechnik der Zukunft – sind aber bereits Realität: smarte Textilien, die unsere Atmung oder Herzfunktion überwachen und vor Überforderung warnen.
Dr. rer. nat. Dominik Lausch
»Digitalisierung ist der Schlüssel zur Zukunft!«
Am Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS in Halle (Saale) haben Dr. Dominik Lausch und sein Team eine innovative Technologie entwickelt, die moderne Sensorik und Neuronale Netze verbindet. Darauf basierend hat er mit Kollegen die DENKweit GmbH gegründet. Im Interview erklärt er die Idee hinter der Innovation – die denkbar einfach ist.
Sie sind Geschäftsführer der DENKweit GmbH, einer Fraunhofer-Ausgründung. Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit für die Fraunhofer-Gesellschaft heute?
Bei Fraunhofer zu arbeiten ist vielfältig. Fraunhofer bietet attraktive Programme und damit einmalige Möglichkeiten: Ich hatte mich beim Fraunhofer INNOVATOR-Programm beworben. Eine Ausgründung war mein erklärtes Ziel. Mit dem Fokus auf klare Antworten und einfache Anwendung geben wir bei DENKweit gerade richtig Gas!
Dafür spricht auch die Tatsache, dass Ihr Unternehmen 2019 mit dem IQ Innovationspreis Mitteldeutschland ausgezeichnet wurde.
Unsere Technologie ermöglicht schon im Produktionsprozess eine leistungsfähige Qualitätskontrolle von Batteriezellen für Elektroautos. Sie können zerstörungsfrei, kontaktlos und in Echtzeit auf Anomalien untersucht werden.
Wie geht das?
Der Stromfluss in einer Batterie erzeugt ein Magnetfeld und damit einen magnetischen Fingerabdruck. Elektrische Defekte verändern dieses Magnetfeld. So können wir mit unseren Messdaten auf diese Veränderungen, also die Defekte, rückschließen. Da wir auch einzelne Batteriezellen untersuchen können, gehen wir damit ein aktuelles Problem der E-Mobilität an. Bisher musste beim Verdacht auf einen Defekt das ganze Modul ausgebaut und im Labor analysiert werden. Unser Verfahren lässt sich aber auch auf andere elektronische Komponenten wie beispielsweise Solarmodule übertragen.
Ihr Versprechen: revolutionäre Technologien und mehr Wirtschaftlichkeit in Zukunftsmärkten. Dazu gehört auch die Photovoltaik. Welche Vorstellung haben Sie als Wissenschaftler und Gründer von der Zukunft?
Die Photovoltaik ist ein wichtiger Baustein unserer Energiezukunft. Wir brauchen alternative Energielieferanten. Ich glaube aber, dass es die Politik in Europa verschlafen hat, die richtigen Weichen zu stellen: Viele Leute verstehen die Zukunft nicht. Dabei ist das Verständnis dafür, dass Digitalisierung der Schlüssel ist, absolut essenziell.
Dr. rer. nat. Dominik Lausch war Teamleiter am Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS in Halle (Saale) und ist heute Geschäftsführer der DENKweit GmbH. Die Fraunhofer-Ausgründung bietet eine effiziente Qualitätskontrolle in der Produktion von Batteriezellen, Solarmodulen oder Leistungselektronik an. Die Technologie ist unter anderem mit dem Hugo-Junkers-Preis und dem IQ Innovationspreis Mitteldeutschland ausgezeichnet worden.
Dr. Elena Lopez
WHAT’S NEXT, ELENA LOPEZ - 3D-DRUCK WIRD SO SELBSTVERSTÄNDLICH WIE DAS INTERNET
An einem kühlen Dresdner Morgen unterhält sich Elena Lopez im Foyer des Fraunhofer IWS mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Gäste des heutigen Tages begrüßt die Abteilungsleiterin Additive Fertigung mit großer Warmherzigkeit. Der charmante Akzent der gebürtigen Spanierin unterstreicht ihre freundliche und offene Art. Sie kam vor 16 Jahren als Erasmus-Studentin nach Deutschland. Heute stehen ihre Fachkarriere und -kompetenz beispielhaft für exzellente Fraunhofer-Forschung.
In den Tag startet sie jetzt mit einer Führung durch das Technikum. Die helle Halle ist das Herzstück ihres Forschungsbereichs. Gleich rechts passiert man ein großes geschlossenes Rolltor. »HybR-Lab« lautet der Hinweis auf dem Schild daneben. Im großzügigen Raum stehen unzählige Anlagen unterschiedlicher Größe. Die Wissenschaftlerin erklärt, worum es geht: »Additive Fertigung bedeutet, dass wir im 3D-Druck Schicht für Schicht neue, oft sehr komplexe Geometrien für zahlreiche Anwendungsfelder aufbauen.«
Das Ausgangsmaterial und auch die Verfahren dafür sind vielfältig. Ganz hinten rechts entsteht gerade ein Demonstrator im Pulverbettverfahren. Der Vorteil dieses sogenannten Laserstrahlschmelzens ist unter anderem die hohe Geometriefreiheit. Durch das kleine Sichtfenster leuchtet ein Laser, der auf einem vorbestimmten Verfahrweg auf das Pulverbett trifft. Der Pulverwerkstoff wird lokal geschmolzen und bildet, nachdem er erstarrt ist, eine feste Materialschicht. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis alle Schichten umgeschmolzen sind. Ein Beispielprodukt ist auf dem Tisch nebenan zu sehen: Der Unterbau dieses Metallgebildes in einer tellerartigen Halbkreisform besteht aus einem sehr feingliedrigen Gitter. »Das ist ein Prototyp eines optischen Spiegels, hergestellt im Rahmen eines Projekts mit der European Space Agency. Hier kommt eine spezielle Aluminium-Silizium-Legierung zum Einsatz. Ihr Steifheits- und Ausdehnungsverhalten ist entscheidend für eine optimale Leistung des Spiegels«, erläutert Lopez. Die vielen Partner des Fraunhofer IWS stammen indes nicht nur aus der Luft- und Raumfahrtindustrie. Auch Branchen aus dem Energiebereich und der Elektrotechnik, die Automobilindustrie, der Schienenfahrzeugbau und die Medizintechnik profitieren von ihrer Arbeit. Ihr Team und sie begleiten die Projekte von der Idee über die Machbarkeitsstudie und die Entwicklung der Systemtechnik bis hin zur Marktreife eines Produkts. Dabei hat Elena Lopez immer die Fäden in der Hand.
Elena Lopez wurde in Madrid geboren und kam als Erasmus-Stipendiatin nach Deutschland. Nach ihrem Diplom an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ersten Industrieerfahrungen bei Siemens promovierte die Forscherin mit einem Marie-Curie-Stipendium an der TU Dresden. Als Abteilungsleiterin am Fraunhofer IWS beweist sie seit 2017 strategische Kompetenz, wissenschaftliche Exzellenz und großes Organisationstalent. »An meinem Schreibtisch sitze ich selten. Ich bin viel unterwegs, am Institut gibt es ständig Projekt-, Team- oder Managementbesprechungen. Und die Geschäftsstellenleitung unserer Strategieallianz AGENT-3D nimmt gut ein Drittel meiner Arbeitszeit ein.« Dieses Konsortium aus führenden Forschungseinrichtungen, Industrievertretern sowie kleinen und mittleren Unternehmen wird im Rahmen des Programms »Zwanzig20« mit 45 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Sein Ziel ist es, die Technologieführerschaft Deutschlands in der additiven Fertigung voranzutreiben. »Es gibt dieses Netzwerk seit 2014. Ich habe früh die Chance bekommen, die Leitung zu übernehmen, und bin stolz, hier einen Beitrag leisten zu können. Inzwischen haben wir das Programm und den Standort Dresden als Hotspot der additiven Fertigung erfolgreich international positioniert und sind jetzt in der Umsetzungsphase«, erklärt Lopez. Für sie bedeutet das, die Projekte zum Erfolg zu führen. In der Zukunft wird dank ihrer Arbeit – am Institut, aber auch im Additive Manufacturing Center Dresden (AMCD), dem Kompetenzzentrum der TU Dresden und des Fraunhofer IWS, sowie bei AGENT-3D – additive Fertigung genauso selbstverständlich sein wie das Internet.
Klarheit zeichnet ihren Arbeits- und Kommunikationsstil aus. Jeder im Team kennt seine Aufgaben und Ziele genau. Und Lopez sorgt dafür, dass sie diese Ziele gemeinsam erreichen. Dabei hat ihre enge Zusammenarbeit eine ganz besondere Qualität: »Ich wünsche mir, dass wir uns im Team nicht nur beruflich austauschen. So kenne ich das aus Spanien. Wir sprechen auch über private Themen oder unternehmen auch mal etwas in der Freizeit.«
Am Nachmittag steht noch mal das Technikum auf dem Programm: »Wir können jetzt einen Blick auf die hybride Fertigung werfen«, sagt Lopez. Dort angekommen, öffnet sie das Rolltor, und das Schild mit der Abkürzung »HybR« ergibt jetzt Sinn: Hier stehen sich zwei riesige orangefarbene Laserroboter gegenüber. Sie kombinieren konventionelle industrielle und additive Fertigung zum entsprechenden Hybrid-Verfahren. So werden Werkstoffeigenschaften und Bauteilstrukturen weiter optimiert. Leider kann Lopez das Thema heute nicht mehr vertiefen: Sie hat noch ein Teammeeting angesetzt. Und danach lädt die Abteilungsleiterin zu einem Glühwein auf dem Dresdener Neumarkt ein. Und so geht dieser Wintertag mit einem kleinen Teamevent zu Ende, das Elena Lopez mit ihrer besonderen Wärme und Herzlichkeit begleitet.
Als Abteilungsleiterin Additive Fertigung am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS hat Dr. Elena Lopez ein wichtiges Zukunftsziel: Vorreiter und Schrittmacher in ihrem Forschungsgebiet zu sein. Am Wissenschaftsstandort Dresden sorgt sie deshalb dafür, dass die 3D-Revolution des Digitalzeitalters ankommt – in den Köpfen, in der Industrie und im Alltag.
Wolfgang Oesterling
WHAT’S NEXT, WOLFGANG OESTERLING: EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN
Wolfgang Oesterling ist Verwaltungsleiter am Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg. Wer den studierten Maschinenbau-Ingenieur einen Tag lang begleitet, versteht sehr schnell, welchen Stellenwert der Faktor Mensch für die Verwaltung bei Fraunhofer hat.
Wenn Wolfgang Oesterling Urlaub macht, dann arbeitet er 10 Tage lang als Koch für Kinder in einem Zeltlager. Hier empfindet er das Gegenteil von Stress. »An einem Vormittag hundert Zwiebeln schneiden? Kommt meinem Idealbild von Entspannung ziemlich nahe!«, erzählt der Endfünfziger. Zutaten bereithalten, den Überblick behalten, dafür sorgen, dass der Laden läuft: Hier ist Oesterling in seinem Element.
Wenn Wolfgang Oesterling am Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg Bewerbungstools und Auftragsmasken checkt, Zahlungen anweist und sich mit der Digitalisierung von Abläufen beschäftigt, dann ist das ebenfalls genau sein Ding: Als Verwaltungsleiter setzt er die organisatorischen Rahmenbedingungen für ein Institut mit einem Betriebshaushalt von fast 20 Millionen Euro. Bei 230 Kolleginnen und Kollegen ist Vielfalt garantiert – auch im Arbeitsalltag. Wer hier forscht, ist Individualistin und Idealist. Die Verwaltung ist für jeden da. »Und das mit einem Gespür für den Menschen«, sagt Oesterling »Dieses Gefühl, einer für alle, alle für einen, es darf uns nicht verlorengehen!« Wolfgang Oesterling sitzt in seinem bescheiden wirkenden Büro. Jeden Auftrag unterschreibt der Verwaltungsleiter selbst. Das ist sein Arbeitsalltag heute. Ebenso beschäftigt ihn die Arbeit der Zukunft. »Auch bei uns geht es um Homeoffice-Möglichkeiten, um New Work, um Frauen in MINT-Berufen. Für uns zählt dabei, die richtige Rezeptur zu finden, schließlich müssen wir die besten Forscherinnen und Forschern an uns binden.«
Das Fraunhofer IPM entwickelt maßgeschneiderte Messtechniken und Systeme für die Industrie – ambitioniert, maßgeschneidert und an der Grenze des Machbaren. Dabei entstehen ganz konkrete Erfindungen für die Zukunft: der FCKW-freie Kühlschrank oder ein Trackingsystem für Europaletten, um diese markerfrei wiedererkennen zu können – und zwar weltweit. Hinzu kommen gigantische Projekte wie etwa die automatisierte Trassenplanung für den Glasfaserausbau in Deutschland, die das Fraunhofer IPM für die Telekom entwickelt hat. Voraussetzung für das Gelingen? »Der Laden muss laufen wie ein Uhrwerk – reibungslos, präzise und relativ leise. Und«, Oesterling wiederholt es, weil es ihm so wichtig ist, »mit einem Gespür für den Menschen.« Ein besonderes Anliegen ist es, den hohen Vernetzungsgrad der Abteilungen beizubehalten. Hier zählt vor allem eines: Kommunikation – auch über den Tellerrand des eigenen Forschungsschwerpunkts hinaus. Die von seinem Vorgänger initiierte »Kaffeerunde« ist ein Beispiel dafür: Täglich stehen die Teams um 10.30 Uhr im Atrium des Gebäudes, tauschen sich über Kunden, Projekte und Aufträge aus. Das Stimmengewirr wird dichter, studentische Hilfskräfte sprechen mit Abteilungsleitern, Feinmechaniker mit Elektronikern und mittendrin auch der Institutsleiter und sein Verwaltungschef. »Zahlreiche unserer besten Projekte haben hier ihren Anfang genommen – manche durch kommunikativen Zufall.«
What’s next, Wolfgang Oesterling? »Man kann die Zukunft nicht vorhersagen. Aber man kann auf sie vorbereitet sein!« Am frühen Nachmittag steht ein sehr konkretes Zukunftsprojekt auf der Tagesordnung: die Besichtigung des neuen Institutsgebäudes auf dem Campus der Technischen Fakultät der Universität Freiburg. Als Teil des »Sustainable Energy Valley« entstehen auf 7500 Quadratmetern Büro-, Besprechungs- und Laborräume im Wert von 43 Millionen Euro. Noch lässt die Baustelle mit ihren Baggern, all dem Schutt und Baustaub kaum erkennen, dass der Umzug bereits 2020 anstehen soll. Wolfgang Oesterling bringt das nicht aus der Ruhe. »Das wird schon«, sagt der Verwaltungschef, und er sagt es sehr entspannt. Auch im Zeltlager als Hobbykoch für hungrige Kinder hat er nie auch nur eine einzige Zutat vergessen.
Prof. Boris Otto
WHAT’S NEXT, BORIS OTTO: ECHTE LIEBE
Prof. Boris Otto ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik ISST in Dortmund. Als Wirtschaftsinformatiker beschäftigt er sich nicht nur mit Prozessoptimierung und Geschäftsmodellen, sondern auch mit innovativen Technologien – die er am liebsten selbst mitentwickelt und voranbringt. Begleitet man ihn einen Tag lang, erfährt man, warum Daten heute und in Zukunft das Erfolgspotenzial deutscher Unternehmen sind.
»Ich hätte nicht gedacht, dass mir schwindelig wird«, sagt Prof. Boris Otto. Er setzt die VR-Brille ab und rückt die eigene zurecht. Im VR-Raum seines Fraunhofer-Instituts hat er heute erstmals einen digitalen Zwilling getestet, der den OP-Raum eines Krankenhauses simuliert. Tatsächlich, erklärt Otto nun, lösten VR-Umgebungen bei vielen Menschen Schwindel aus, weil die Brille Bewegung suggeriert, während man still steht. Mit der Auflösung der Darstellung ist der Institutsleiter zufrieden, teilt er dem zuständigen Kollegen mit. Im Kreis seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agiert er wie der Trainer eines Teams. Entsprechend setzt der Fußballfan an seinem Fraunhofer-Institut auf Mannschaftserfolg.
Ein solcher soll auch der aktuelle Forschungsschwerpunkt werden: »Wir arbeiten zurzeit an digitalen Zwillingen. Im OP erleichtern sie beispielsweise die Zusammenarbeit. Sie ermöglichen aber nicht nur im Gesundheitswesen Risikoanalysen, Simulationen oder Auswertungen. Damit werden Firmen flexibler, die Produktion wird effizienter – und das Leben einfacher«, sagt Otto. Im Fokus stehen Daten. Es geht um die Frage, wo sie herkommen und wer was damit macht. Vor allem aber geht es um die Geschäftsmodelle, die sie ermöglichen. Das Plädoyer des Digitalisierungsforschers: »Daten-Ökosysteme, wie wir sie in den Domänen Logistik, Gesundheitswesen und in der Datenwirtschaft selbst vorantreiben, sind ein wichtiger Baustein, wenn Innovationen unser Ziel sind«, erklärt er. Dieser Ansatz fußt nicht nur auf Daten als strategischer ökonomischer Ressource. Er setzt vor allem darauf, dass Verbundorganisationen entstehen. »Die Branchen, mit denen wir zusammenarbeiten, stehen neuen, datengetriebenen Geschäftsmodellen gegenüber. Eine Herausforderung, die wir nicht allein den Microsofts und Amazons überlassen sollten«, so die Einschätzung des Experten.
Wenn Otto am späten Vormittag über seine Aufgaben spricht, tut er das aufgeräumt und präzise. Und auch wenn jeder Tag anders ist – durchgetaktet sind alle. Für plan- und umsetzbar hält der Stratege auch eine erfolgreiche deutsche Digitalzukunft. Die viel zitierte These, Deutschland habe die Digitalisierung verschlafen, hält er für unreflektiert. Er vertraut auf Deutschlands Stärken: Domänenwissen und die Systeme, die Daten produzieren. Und er glaubt an Deutschlands Chance: Plattform sein statt nur die App! Plattformzentrierte Unternehmen aus dem Consumerbereich wie Uber machten das vor. »Die lösen ein Problem end-to-end und vernetzen alle Daten.« Die deutsche Industrie befinde sich rund um das Digitalisierungsthema im Umbruch. Gerade im Strukturwandel lägen aber auch die zukünftigen Möglichkeiten, betont er während eines Rundgangs am westlichen Rand der City. Er blickt auf das Dortmunder U – eine ehemalige Brauerei, die heute ein Kunstmuseum ist – und schwärmt von seiner Stadt: »Hier in Dortmund lebt man seit Jahrzehnten Transformation. Und sie gelingt mit ›echter Liebe‹!« Der gebürtige Hamburger erklärt auch, warum er sich im Ruhrpott wohlfühlt: »Die Leute sind unaufgeregt, ehrlich, eben ganz down-to-earth.«
Der 48-Jährige weiß, wovon er spricht – egal ob es um Fußball oder Datenwirtschaft geht: Vor seiner Zeit am Fraunhofer ISST hat er in der Wirtschaft und an Universitäten im In- und Ausland gearbeitet. Promoviert hat er 2002 beim ehemaligen Fraunhofer-Präsidenten Hans-Jörg Bullinger am Fraunhofer IAO. Heute bringt der Datenexperte sein Thema mit einem Vergleich auf den Punkt: Daten sind wie Strom aus der Steckdose. Dass wir davon abhängig sind, merken wir erst, wenn das Licht nicht angeht. Damit also datenbasierte Modelle funktionierten, müsse das Bewusstsein für ihre Relevanz da sein. Darum geht es heute am Fraunhofer ISST – um den Umgang mit Daten, um Datensicherheit, Datensouveränität und Datenethik. Das Zukunftsziel lautet, Datenmanagement als Unternehmensaufgabe wie Einkauf, Buchhaltung oder Logistik zu etablieren.
Erlebt man Otto im Gespräch, wird deutlich, wie lösungsorientiert er seine Mannschaft führt. Thema ist der Digital-Gipfel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, der Ende Oktober in Dortmund stattfand. Der Schwerpunkt: Digitale Plattformen. Das Fraunhofer ISST war unter anderem mit einem Exponat zur »Digital Life Journey« vertreten, mit dem wir unseren persönlichen digitalen Zwilling verwalten können und sehen, welche App was mit unseren Daten macht. Der Umgangston während der Teambesprechung und auch auf den Fluren des Instituts ist freundlich-kooperativ. »Dass ich die Kolleginnen und Kollegen, meine Studentinnen und Studenten duze, heißt nicht, dass ich keine gute Leistung von ihnen erwarte«, sagt Otto.
Am späten Nachmittag steht der letzte Termin des Tages an. »Unsere beiden Söhne spielen im Verein Fußball. Ich hole nachher unseren älteren Sohn vom Training ab«, erzählt er. Früher habe er selbst gespielt, seine Samstage gehörten nun den Fußballmatches der beiden Kinder, und überhaupt sei der Ruhrpott die Hochburg der Fußballkultur. Boris Otto zieht seinen Lieblingssport auch zu einem abschließenden Vergleich zum Institut heran: »Momentan bin ich eine Art Spielertrainer. Irgendwann möchte ich mich vom Spielfeld mehr an die Seitenlinie bewegen, um mich stärker dem Coaching des Teams widmen zu können«, so der Plan. Seine Fach- und Führungskompetenz werden dabei helfen – angekommen in einer der signifikantesten Metropolen des Strukturwandels ist er ja schon.
Dr. Anne-Julie Maurer
»Forschung für die Menschen ist die Zukunft!«
Als junge Forschungsmanagerin am Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF legt Dr. Anne-Julie Maurer einen Schwerpunkt auf die interdisziplinäre Kooperation, damit noch umfassendere komplexe Forschungsprojekte möglich werden. Hier spricht sie über die Verbindung von Zukunftsthemen und öffentlichem Interesse – und darüber, warum Forschungsmanagerinnen bei Fraunhofer so stark vernetzt sind.
Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft bei Fraunhofer?
Ich wünsche mir, dass wir als Fraunhofer-Gesellschaft gemeinsam große Initiativen anpacken und große Themen wie die Energiewende oder die Quantentechnologie Realität werden lassen. Vor allem aber müssen wir an der Schnittstelle von Industrie und Wissenschaft dafür sorgen, die Menschen draußen mitzunehmen und für wissenschaftliche Ergebnisse zu begeistern. Forschung für die Menschen ist die Zukunft.
Was, meinen Sie, ist für die Öffentlichkeit besonders interessant?
Nachhaltigkeit stößt derzeit auf ein breites öffentliches Interesse. Ebenso wie große Fraunhofer-Erfindungen – nehmen wir die weiße LED oder mp3 –, die Einzug in den Alltag gehalten und einen greifbaren Nutzen für die Menschen haben. Bei meiner Arbeit versuche ich, eine Position von außen einzunehmen und der Öffentlichkeit den Nutzen unserer Forschung zu erklären.
Was haben Sie aus dem Fraunhofer-Forschungsmanager-Programm für Ihre aktuellen Aufgaben mitgenommen?
Ich nenne die Ausbildung immer den größten Glücksfall meiner Karriere! Ich habe einen einzigartigen Rundumblick über die Möglichkeiten der erfolgreichen Verwertung von Forschung bekommen. Ob es die großartigen internen und externen Referenten waren oder unsere gemeinsamen Projekte – ich schöpfe bis heute aus einem unermesslichen Vertrauens- und Wissenspotenzial. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer rufe ich gern regelmäßig an, wenn ich Fragen habe oder Rat brauche. Dieser Austausch und der lebenslange Wissensdurst, das sind für mich wirklich wichtige Werte – Werte, die Fraunhofer tatsächlich lebt und die vielleicht sogar noch intensiver gelebt werden könnten.
Dr. Anne-Julie Maurer leitet ein 9-köpfiges Team im Bereich Marketing und Kommunikation am Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF in Freiburg. Die 34-Jährige hat englische Sprachwissenschaft studiert und in Linguistik promoviert. An das Fraunhofer IAF kam sie bereits während ihrer Doktorarbeit. Sie ist in dieser Zeit in die physikalisch-wissenschaftliche Welt des Instituts eingetaucht; von 2014 bis 2016 war sie Referentin des Institutsleiters und hat im April 2016 ihre Weiterbildung zur Fraunhofer-Forschungsmanagerin abgeschlossen. Im Prädikatsprogramm der Fraunhofer Academy lernen Fraunhofer-Talente, ihre Handlungsfähigkeit an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft zu gestalten und den Transfer von Forschungsergebnissen institutsübergreifend zu erhöhen
Dr. Sven Meister

»Was wir in Zukunft unbedingt brauchen? Einen Tricorder, der den menschlichen Körper ganzheitlich erfasst und Therapien personalisiert!Heute arbeiten wir erst einmal an einer Art digitalem Zwilling. Das Ziel ist, den Einzelnen zum Souverän seiner Daten zu machen, der entscheidet, was wer zu welchem Zeitpunkt mit den Daten machen darf. Das ist eine Grundlage für unsere Modelle Künstlicher Intelligenz im Bereich Epilepsie, Parkinson oder auch bei Stress. Ich habe dabei keine Erwartungen an die Zukunft, sondern freue mich, den Augenblick zu gestalten und Innovationen hervorzubringen. Ganz nach Ina Deter: ›Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk.‹«
Dr. Sven Meister ist Abteilungsleiter Gesundheitswesen am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST in Dortmund, einem Vorreiter in der Entwicklung von Krankenhaus-IT. Er betreut den Bereich Digitalisierung und ist in der Initiative »Smart Medical Information Technology for Healthcare (SMITH)« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aktiv.
Dr. Dirk Nüßler

»Wir brauchen ein ganzes Bündel kluger Ideen, um die große Herausforderung unserer Zeit zu meistern: z.B. die umweltschonende Erzeugung und Speicherung von Energie! Allgemein gilt es standortübergreifende, interdisziplinäre Forscherteams zu bilden. Gemeinsam mit Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen nach kreativen Lösungen zu suchen, darauf freue ich mich in der immer vernetzteren Welt der Zukunft besonders.«
Dr. Dirk Nüßler ist Abteilungsleiter Integrierte Schaltungen und Sensorsysteme am Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR in Wachtberg, Nordrhein-Westfalen. Er treibt die Entwicklung von Radarsystemen voran, z. B. kompakte, intelligente Sensoren zur Produktionsüberwachung.
Dr. Elisabeth Peinsipp-Byma
WHAT’S NEXT, FRAU PEINSIPP-BYMA - DAS NEUE BILD DER ZUKUNFT
»Frau Dr. Peinsipp-Byma wird jeden Moment kommen.« Der Pressereferent des Fraunhofer IOSB blickt konzentriert auf einen Zettel. »Die Tagesordnung«, sagt er erklärend. Als sei das Wort eine magische Zauberformel, öffnet sich wie auf Kommando die Fahrstuhltür zum Empfangsbereich des Instituts und Frau Dr. Peinsipp-Byma erscheint.
Jedes Klischee, das sich beim Betrachter aufbauen könnte, torpediert die Forscherin mit fokussierten, punktgenauen Ansagen: sei es bereits am frühen Mittwochmorgen bei einem Kundentermin oder nun bei unserem Besuch auf Fragen nach ihrer Vita.
»Ich habe in Graz Technische Mathematik studiert. Bei Fraunhofer hat mich das exzellente technische Equipment überzeugt. Sun-Rechner, Transputer, Roboterarme: Von Anfang an gab es hier einfach alles. Und was nicht vorhanden war, das haben wir selbst gebaut.« Behilflich seien dabei auch das unterschiedliche Wissen und der erfrischende Background von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Nationen gewesen – damals aus Pakistan und China beispielsweise, wie die Forscherin beiläufig bekennt.
Heute ist Dr. Elisabeth Peinsipp-Byma Leiterin der Abteilung Interaktive Analyse und Diagnose in Karlsruhe, wo sie mit ihren Teams für Auftraggeber aus Industrie und Behörden Projekte in Bereichen wie etwa Medizin, Automotive und Produktion umsetzt. Im Fokus steht dabei immer die Bild- und Informationsauswertung im Zusammenhang mit dem Faktor Mensch als wesentliche Größe: hochmodern, intelligent und interaktiv. »Selbstverständlich befassen wir uns auch mit KI.« Die Wissenschaftlerin fädelt Inhalte auf wie Perlen auf eine Schnur. »Was mich hier ärgert? In der öffentlichen Debatte werden zunehmend Ängste geschürt. Da heißt es, durch KI-Verfahren würden Menschen einfach wegprogrammiert. Aber«, Peinsipp-Byma richtet ihre Perlenkette, »ohne Menschen geht es gar nicht! Für den Menschen sind wir schließlich da.«
»Unsere Tools zur Informationsauswertung unterstützen auch das Erkennen kritischer Situationen.« Die Wissenschaftlerin hat sich bereits schnellen Schrittes auf den Weg in den Smart Control Room des Instituts begeben. Ihr Weg führt sie in einen garagenhaft wirkenden Raum, in dem ein Pkw vor einem riesigen, eine Landstraße visualisierenden Screen steht. »Im Projekt InCarIn haben wir eine Anwendung entwickelt, die die individuellen Bedürfnisse der Passagiere erfasst. So kann das Auto auf sie eingehen und reagieren. Tiefensensoren spielen dabei eine entscheidende Rolle«, führt Peinsipp-Byma mit Blick auf den Demonstrator aus. »Heute geht der Blick in Richtung autonomes Fahren – und dahin, was die Fahrerin macht, wenn sie die Fahraufgabe übernehmen soll. Ist sie gerade eingenickt oder arbeitet sie an ihrem Tablet?« Abhängig von der Aktivität muss die betreffende Person anders »aktiviert« werden – und das bisweilen in Sekundenschnelle.
Das sind die Themen von Peinsipp-Byma: wahrnehmende Systeme entwickeln, die die Aktivitäten des Menschen erkennen – und Augmentierte Realitäten erforschen, welche Informationen so anzeigen, dass Menschen, etwa Werker in der Produktion, sie sofort erfassen und umsetzen können. »Unterstützungssysteme« nennt sie das – eine weitere Perle auf der geraden Schnur an Themen und Demonstratoren, die Peinsipp-Byma mit ihren Teams für unseren Besuchstag mit Genauigkeit und Akribie vorbereitet hat. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter erklärt eine Anwendung, die sich mit den Realitäten des Baubooms in Großstädten auseinandersetzt und bauliche Veränderungen durch entstehende Gebäude graphisch visualisieren hilft. Die Anwendung »CoBot« präsentiert sich mit eindrucksvollen und hilfreichen Greifarmen. Ihr Ziel: den Menschen bei der Montage durch eine intelligente Mensch-Maschine-Interaktion zu unterstützen. Ein weiteres Projekt zur gestenbasierten Fehlermarkierung ermöglicht eine schnelle und intuitive Qualitätssicherung im Automobilbereich.
Ein besonderes Anliegen sind Elisabeth Peinsipp-Byma Entscheidungsunterstützungssysteme für den maritimen Bereich. Sie sollen Europas Meere sicherer machen, indem sie Menschenschmuggel und Piraterie erkennen. Die Forscherin spricht mit der Zurückhaltung einer Diplomatin über diese Themen, die einerseits die Forschung ihres Instituts mit prägen, andererseits aber derart sicherheitsrelevant sind, dass Diskretion durchaus angezeigt ist. »Wir befassen uns auch leidenschaftlich mit Nachhaltigkeitsthemen«, führt sie aus. »Zum Beispiel Fischfang. Heute wird jeder dritte Fisch illegal gefischt. Durch die Auswertung entsprechender Informationen ist es auch möglich, nachzuvollziehen: Woher kommt der Fisch auf dem Tisch?« Solchen Zielen könne die Datenauswertung genauso dienen wie der Qualitätssicherung industrieller Produktionsstraßen. »Wir haben eine Greta gebraucht, um die Wichtigkeit von Klimakrise und Nachhaltigkeit neu zu begreifen«, sagt Peinsipp-Byma. »Jetzt ist es auch an uns, diese Haltung in die angewandte Forschung zu übertragen.«
Dazu passt es nur zu gut, dass sich Elisabeth Peinsipp-Byma am liebsten von der Ruhe der Natur inspirieren lässt: Ihren Tag lässt gerne auch im Botanischen Garten ausklingen. Der Park mit seiner Orangerie und den Gewächshäusern ist für sie kräftigender Ort und Inspirationsquelle zugleich. In Gedanken, so scheint es, ist die Abteilungsleiterin auch hier schon bei einem neuen Thema oder einem neuen der unzähligen Projekte, die sie in ihrer Abteilung koordiniert. Möglicherweise betrachtet sie auch nur die Vielfalt an Blumen, wobei sie stets auf neue Gedanken kommt. In beiden Fällen wird daraus eine neue Perle entstehen, für die schnurgerade Kette, die glücklicherweise rund ist und wie der Ehrgeiz der Wissenschaftlerin nie ein Ende findet. Mit aufrichtiger, zu Herzen gehender Höflichkeit bedankt sich die Forscherin beim ganzen Team, bevor sie auf dem Fahrrad ihren Weg antritt, auf die Minute genau zur auf dem Blatt des Pressereferenten vermerkten Tagesordnung.
Dr. Elisabeth Peinsipp-Byma leitet die Abteilung für Interaktive Analyse und Diagnose am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe. Wer sie einen Tag lang begleitet, bekommt ein eindrucksvolles Bild vom Forschungsspektrum des Karlsruher Instituts – einen Besuch im Botanischen Garten der Stadt inklusive.
Dipl.-Logist. Christian Prasse

»What’s next? Hoffentlich eine gerechte, gesunde und freundliche Welt! Durch unsere Entwicklungen tragen wir dazu bei, die Zukunft in diesem Sinne zu gestalten. Ich selbst beschäftige mich mit Logistikprozessen – von der Transportlogistik bis hin zum Management von globalen Wertschöpfungsnetzwerken. Wir sind überzeugt: Wer die Logistikketten der Welt steuert, versteht die Wirtschaft der Welt – und kann diese aktiv mitgestalten. Hier gilt es, als Institut und persönlich einen Beitrag zu leisten, um dies in einer föderalen, offenen Weise und mit Teilhabe von Unternehmen und Partnern jeder Größe zu ermöglichen.«
Dipl.-Logist. Christian Prasse ist Leiter Strategische Entwicklung am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund. Er hat maßgeblich zur Realisierung des Fraunhofer Enterprise Lab beigetragen, eines innovativen Formats der gemeinsamen Forschung von Industrie und Wissenschaft, das inzwischen Fraunhofer-weit im Einsatz ist.
Hans-Martin Pastuszka

»Auch zukünftig zur Wahrung des Friedens in Europa beitragen zu können, darauf freue ich mich sehr! Hierzu leistet die Bundeswehr einen wichtigen Beitrag. Frieden langfristig sicherzustellen ist auch Auftrag meines Forschungsbereichs – durch frühzeitiges Erkennen, Beobachten und Bewerten von neuen technologischen Entwicklungen. Dies ist für mich von besonderer Bedeutung und Teil meiner täglichen Arbeitsmotivation. Schließlich geht es darum, die Sicherheit Deutschlands und der Europäischen Union zu festigen und beide dauerhaft lebenswert und so gerecht wie möglich zu gestalten.«
Hans-Martin Pastuszka ist stellvertretender Abteilungsleiter Technologieanalysen und Strategische Planung und Geschäftsfeldleiter Wehrtechnische Zukunftsanalyse am Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT in Euskirchen. Er ist unter anderem für das Bundesministerium der Verteidigung tätig.
Dr. rer. nat. Daniel Rapoport
»Ich wünsche mir, dass meine Forschung dazu beiträgt, künftig die Versorgung von Menschen und Tieren mit tierischem Eiweiß zu sichern. Beispielsweise ließe sich in Bioreaktoren ressourcenschonend zellbasierter Fleischersatz herstellen: ›cultured meat‹. Für mich ist relevant, an technischen Lösungen zu arbeiten, die unter geeigneten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen helfen werden, die Probleme der Zukunft zu lösen.«
Dr. rer. nat. Daniel Rapoport ist Abteilungsleiter Zelltechnologie an der Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik EMB in Lübeck. Er hält diverse Patente, unter anderem für ein besonders effizientes Verfahren zur Zellvermehrung.
Dr.-Ing. Beate Rauscher
»Wir finden und erforschen heute die Themen von morgen!«
Dr.-Ing. Beate Rauscher ist Forschungskoordinatorin im Vorstandsstab Forschung in der Fraunhofer-Zentrale. An der Schnittstelle zwischen den Instituten und dem Vorstand recherchiert sie, welche Forschungsthemen im gegenwärtigen Diskurs besonders relevant und zukunftsträchtig sind. Im Interview spricht sie über technische Expertise, das Verschmelzen der Disziplinen und darüber, was sie so durchsetzungsstark gemacht hat.
Kann man sagen, dass Sie als Forschungskoordinatorin ganz nah dran sind an der Zukunft?
Durchaus. Denken Sie beispielsweise an Next Generation Computing. Es geht um die Frage: Wie können wir Rechner noch schneller und effizienter machen? Ein spannendes und hochkomplexes Thema! Selbstverständlich liegt die Expertise bei den Instituten. Aber als Bindeglied zwischen den Instituten, dem Vorstand und der Politik müssen wir alles so weit durchdringen, dass wir den Kontext verstehen und ihn Menschen mit Entscheidungsbefugnis erläutern können.
Das klingt extrem herausfordernd!
Jedes Team hat sein Spezialgebiet, und wir tauschen uns natürlich intensiv aus. Das Interessante an Themen wie dem Next Generation Computing ist, dass die einzelnen Disziplinen immer stärker ineinandergreifen. Dieses institutsübergreifende Denken und Zusammenarbeiten ist mir sehr wichtig. Wenn wir Gespräche mit den Instituten führen, geht es mir nicht nur um das technische Verständnis für ein Institut oder um seine Wirtschaftsdaten, sondern darum, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das Gefühl, die Institute strategisch unterstützen zu können, treibt mich an. Die Kolleginnen und Kollegen an den Instituten sollen wissen, dass sie sich jederzeit an mich wenden können. Vielleicht eine typisch weibliche Herangehensweise …
Aber eine weibliche Note ist doch auch etwas Positives. Und gerade die Fraunhofer-Gesellschaft fördert Frauen in Forschung und Führungspositionen z. B. durch das Programm Fraunhofer TALENTA.
Selbstverständlich. Wir haben konkrete Zielvorgaben, und ich sitze in der TALENTA-Jury. Bei meinem Elektrotechnik-Studium musste ich mir damals noch sagen lassen, dass ich einem Mann den Studienplatz wegnähme. Da war ich schon baff. Aber so habe ich auch schnell gelernt, mich durchzusetzen!
Dr.-Ing. Beate Rauscher ist Forschungskoordinatorin im Vorstandsstab Forschung in der Fraunhofer-Zentrale. Als Ansprechpartnerin für die Institutsleitungen ebenso wie für Ministerien, Universitäten oder die Wirtschaft gestaltet sie nicht nur die personellen, finanziellen und inhaltlichen Entwicklungslinien der Fraunhofer-Gesellschaft, sondern arbeitet im Auftrag des Vorstands auch an übergreifenden strategischen Projekten.
Dr. Christian Reimann
»Wir stellen perfektes Silizium her: für eine erfolgreiche und bezahlbare Energiewende!«
Reimann leitet die Gruppe Silizium am Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB in Erlangen. Mit seiner Forschung leistet der Mineraloge einen wichtigen Beitrag für unsere Energiezukunft.
In der Presse wird Ihr Institut oft als »energietechnisches Reallabor« bezeichnet. Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Zukunftsbeitrag?
Beim Thema Energieversorgung und -effizienz ist die Photovoltaik ein wichtiger Baustein. Hier leisten wir einen guten Beitrag, um den Wirkungsgrad von Solarzellen zu erhöhen und die Kosten für Solarstrom zu senken. Schließlich liefert mein Forschungsbereich das Grundmaterial für die Siliziumsolarzellen der Photovoltaik: Siliziumscheiben, sogenannte Wafer. Dafür wird Silizium in möglichst hoher Materialqualität benötigt. Am Fraunhofer IISB züchten wir diese Siliziumkristalle.
Es klingt ja fast ein bisschen »märchenhaft«, aber Sie sind wirklich Kristallzüchter?
Ja, das ist absolut zutreffend. Ich beschäftige mich mit der Technologie zur Herstellung kristalliner Strukturen. Nehmen wir einen perfekten Diamanten. Er ist besonders schön und funkelnd. So kommt er in der Natur sehr selten vor und ist deshalb besonders teuer. Genau diese Perfektion ist unser Ziel, wenn wir die Natur in der Kristallzüchtung kopieren.
Und wie sieht die Züchtung von Siliziumkristallen konkret aus?
Kristallzüchtung ist wie Kuchenbacken: Man braucht Zutaten, das Silizium, eine Backform, den Tiegel, und einen Backofen, den Kristallisationsofen. Während des Backens, der Schmelze, entstehen z.B. Fremdpartikel – durch den Tiegel selbst und die Atmosphäre im Tiegel. Diese Fremdpartikel möchten wir vermeiden. Und zwar, indem wir den Prozess des Vermischens mit innovativen und effizienten Verfahren optimieren. Durch unsere Entwicklungen erhöhen wir die Ausbeute der gezüchteten Siliziumblöcke. Früher mussten die mit Fremdpartikeln belasteten Stellen ausgeschnitten werden. Heute produzieren wir perfektes Silizium.
Dr.-Ing. Christian Reimann leitet die Gruppe Silizium in der Abteilung Material am Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB in Erlangen. Seine Pionierarbeit in der Kristallzüchtung für den Halbleiterbereich wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: unter anderem mit dem Ulrich-Gösele-Young-Scientist-Award – benannt nach dem renommierten Wissenschaftler Prof. Dr. Ulrich Gösele, der auch auf dem Gebiet der Halbleiterphysik und -technik geforscht hat.
Manuela Rettweiler
»Wir müssen die Kurve in Sachen Nachhaltigkeit kriegen!«
Manuela Rettweiler ist Referentin der Institutsleitung am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen. Ihr Blick nach vorn richtet sich auf Nachhaltigkeit, alternative Energien und die diesbezüglichen Forschungsansätze in der Fraunhofer-Gesellschaft. Ihre ganz persönliche Zukunftsvision? Teleportation!
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Ein bunter Mix sehr unterschiedlicher Aufgaben: Ich mache klassisches Termin- und Reisemanagement, bereite Präsentationen vor, organisiere Workshops oder erstelle Texte und Protokolle. Als Schutzrechtsbeauftragte halte ich engen Kontakt zur Patentabteilung in München. Ich bin Ansprechpartnerin für die Erfinderinnen und Erfinder, führe Patent- und Marktrecherchen durch oder kümmere mich um Lizenzverträge. Auch rund um das IP-Management, also das Intellectual Property Management, bei dem es um geistiges Eigentum und entsprechende Verwertungsstrategien geht, bin ich inzwischen Anlaufstelle. Manchmal habe ich sehr viele Themen auf meinem Schreibtisch, die alle gleich dringend sind. Dann helfen mir meine Kollegen – und zur Unterstützung landet auch mal eine Tafel Schokolade auf meinem To-do-Stapel.
Man könnte Sie als Spezialistin im Erfinder-Support bezeichnen. Welchen Beitrag leisten Sie damit für unsere Zukunft?
Wenn ich Input für Strategieprozesse liefere, tue ich das im Kleinen: Ich bereite die Zukunft mit vor. Denke ich an die Zukunft, sehe ich aber vor allem, dass uns große Herausforderungen erwarten. Ich frage mich beispielsweise, ob wir es mit Blick auf unseren Planeten schaffen, die Kurve zu kriegen. Hier hoffe ich, dass es der Fraunhofer-Gesellschaft gelingen wird, die richtigen Ansätze zu verfolgen. Denn zu Themen wie CO2-Einsparung, Energieeffizienz, Windkraft und Solarenergie oder Recycling wird ja an den unterschiedlichsten Instituten geforscht.
Apropos Fraunhofer-Forschung: Auf welche Erfindung hoffen Sie persönlich?
Meine Bürokollegin und ich wünschten uns Fortschritte in Sachen Klonen und Beamen: um die Termine unserer beiden Chefs besser koordinieren zu können!
Manuela Rettweiler ist seit 2001 am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen und seit 2016 Referentin der Institutsleitung. 2006 war sie in einem kleinen Team, das den ersten Nachhaltigkeitsbericht bei Fraunhofer erstellt hat. Heute gehören etwa 20 Personen zum Nachhaltigkeitsteam, das regelmäßig interne Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Als Spezialistin für Patent- und Lizenzangelegenheiten ist sie ein Paradebeispiel für eine Fachkarriere bei der Fraunhofer-Gesellschaft.
![]()
Dr.-Ing. Olaf Sauer
»Der Mensch ist unser Kunde – für ihn entwickeln wir Zukunft«
Dr.-Ing. Olaf Sauer ist Stellvertreter des Institutsleiters des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe. Als Spezialist für das Themenfeld Industrie 4.0 arbeiten er und sein Team an praxistauglichen Lösungen für die Fabrik der Zukunft. Im Interview spricht er über eingebettete Minicomputer, smarte IT in der Automobilindustrie – und über seine persönliche Definition der Industrie von morgen.
Die Smart Factory, also die vernetzte Produktion, ist fester Bestandteil der Hightech-Strategie der deutschen Bundesregierung – und soll schon bald Wirklichkeit werden. Stehen wir hier bereits vor einem Durchbruch?
Absolut! Nach meiner Vorstellung einer zukünftigen Fabrik enthalten die relevanten Elemente darin einen eingebetteten Minicomputer, der über Internettechnologie die Kommunikation mit anderen Teilnehmern erlaubt. Und zwar in einer einheitlichen Sprache. Denn eine intelligente Fabrik ist auf allen Ebenen vernetzt, ob mit Kunden, Zulieferern oder mit den Maschinen im Unternehmen selbst. Daran arbeiten wir derzeit mit Hochdruck und für viele industrielle Auftraggeber. Unsere Aufgabe hier bei Fraunhofer ist es schließlich, die Digitalisierung in der industriellen Fertigung voranzutreiben!
Während einige Szenarien davon ausgehen, dass fast jeder zweite Arbeitsplatz hierzulande durch Industrie 4.0 überflüssig wird, sprechen andere davon, dass schlicht andere Jobs entstehen werden. Welche Rolle spielt der Mensch?
Eine unverzichtbare! Er muss verstehen, was passiert. Denn man kann nur kontrollieren und steuern, was man auch interpretieren kann. So wie wir heute ganz einfach einen Drucker anschließen, der dann automatisch funktioniert, stellen wir uns das mittelfristig bei der Smart Factory vor. Das heißt, die Dinge werden einfacher zu vernetzen. Innovationen können schneller vorangetrieben werden. Aber der Mensch wird nach wie vor die letztendliche Entscheidung treffen, seine Kreativität einbringen und auch seine Erfahrung. Das erleben wir schon heute überall dort, wo es smarte Produktionsweisen gibt.
Zum Beispiel?
Nehmen wir das Mercedes-Benz-Werk von Daimler in Bremen. Hier agieren wir wie ein Softwarehaus, haben ein integriertes Leit- und Auswertsystem implementiert. Dabei überwacht unser Produkt ProVis.Agent rund 1.240 Steuerungen von 3.150 Anlagen, vom Rohbau über die Lackierung bis zur Montage. Zusammen mit einer Echtzeit-Visualisierung und der webbasierten Auswertung konnten wir so gemeinsam mit dem Kunden ein komplettes Werk »smartifizieren«, was selbstverständlich nach wie vor von Menschen gesteuert wird. Der Mensch ist unser Kunde – für ihn entwickeln wir Zukunft. Und die liegt in Ideen, die unsere Welt wirklich braucht!
Dr.-Ing. Olaf Sauer ist Stellvertreter des Institutsleiters des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe. Im Geschäftsfeld Automatisierung und Digitalisierung schlägt er die Brücke zwischen Maschinenbau und Informatik. Sein Wissen gibt er auch an seine Studenten am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) weiter, wo er Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Interaktive Echtzeitsysteme ist.
Dr.-Ing. Andrea Schenk
»Wir helfen Patienten – heute und in Zukunft. Das motiviert mich besonders. Die Verbesserung und Automatisierung von Prozessen in der Medizin durch unsere Methoden erleichtert Ärztinnen und Ärzten die Arbeit. Durch unsere Software, die mittlerweile auch Algorithmen der Künstlichen Intelligenz enthält, helfen wir Diagnosen und Therapien zu optimieren und Krankheiten besser zu verstehen. So unterstützen wir Mediziner, Firmen und indirekt auch Patientinnen und Patienten.«
Dr.-Ing. Andrea Schenk ist Mitglied der erweiterten Institutsleitung und Head of Liver Research am Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS in Bremen. Mit ihrem Team hat sie unter anderem Software entwickelt, die dreidimensionale Modelle der Leber und Risiken von Eingriffen berechnet. Dafür wurde das Team 2018 mit dem Joseph-von-Fraunhofer-Preis ausgezeichnet.
Prof. Dr.-Ing. Johannes Schilp

»Mein Zukunftswunsch? Neuartige Besprechungssysteme, die physische Interaktion ermöglichen – für mehr Effizienz im Arbeitsleben und eine bessere Klimabilanz! Nachhaltigkeit leben wir mit unserem ressourceneffizienten neuen Institutsgebäude übrigens auch selbst. Wir wollen kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch große Konzerne auf ihrem Weg in die Zukunft unterstützen: mit digitalen Engineerings, vernetzter Produktion und intelligenten Multimateriallösungen.«
Prof. Dr.-Ing. Johannes Schilp ist Hauptabteilungsleiter Verarbeitungstechnik an der Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV in Augsburg. Parallel hat er den Lehrstuhl für Produktionsinformatik an der dortigen Universität inne.
Dr. Gerno Schmiedeknecht
»Für die Zukunft haben wir viel in der Pipeline!«
Als Hauptabteilungsleiter GMP Zell- und Gentherapie am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI bringt Dr. Gerno Schmiedeknecht klinische Prüfmuster neuer Arzneimittel auf den Weg zum Patienten. Seine Zukunftsprognose: weitere Erfolge im Kampf gegen Krebs, seltene Erbkrankheiten oder HIV.
Sie stellen Arzneimittel für neuartige Therapien, sogenannte ATMP, her und sind mit Ihrer Abteilung auch im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt. Warum?
In unserer Abteilung dreht sich alles um eine gute Herstellungspraxis von Arzneimitteln, dafür steht die Abkürzung GMP (Good Manufacturing Practice). Das heißt: Wir erfüllen extrem hohe Qualitätsstandards. Unsere Kunden – ob große Player in der Pharmaindustrie oder kleine Universitäten – schätzen uns als Partner. So haben wir uns einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet und deshalb auch bei internationalen Projekten die Nase vorn.
Wie hat man sich den Ablauf so eines Projekts vorzustellen?
Wir starten mit einer Akquisephase, die nicht selten bis zu einem Jahr dauert. Nach der Vertragsunterzeichnung geht es um die Projektetablierungsphase, an deren Ende nach 12 bis 15 Monaten die behördliche Herstellungserlaubnis steht. Das eigentliche Herstellungsprojekt nimmt dann ungefähr zwei bis vier Jahre in Anspruch. Man darf aber nicht vergessen, dass wir uns in einem sehr regulierten Bereich bewegen. Und wir sprechen von Aufträgen in Millionenhöhe.
Es geht aber nicht nur um Millionenbeträge, sondern um hochkomplexe Arzneimittel für die individualisierte Behandlung, z. B. von HIV-Patienten.
Ja, richtig. Wir haben im Januar 2019 mit der Etablierung der Herstellung genmodifizierter Stammzellen für die Behandlung von HIV-Infektionen angefangen. Für dieses Präparat konnten Forscherinnen und Forscher des Projektpartners eine zielgenaue Anti-HIV-Aktivität nachweisen. Das ist schon toll! Ich denke, dass wir als profilierter Anbieter auf diesen Auftrag auch im internationalen Vergleich wirklich stolz sein können.
Wird Ihre Arbeit Sie auch in Zukunft stolz machen?
Ganz sicher, denn im Bereich der Zell- und Gentherapie ist viel in der Pipeline. Das heißt, dass auch in Zukunft noch viel passieren wird!
Dr. Gerno Schmiedeknecht war als Biochemiker 2005 einer der ersten Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig und hat einen großen Beitrag zu dessen Entwicklung geleistet. Seit 2009 leitet er zusammen mit Dipl.-Ing. Kati Kebbel die Hauptabteilung GMP Zell- und Gentherapie. Rund 130 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich hier in hochmodernen Reinraumanlagen auf die Prozessentwicklung, Validierung, Herstellung und Qualitätsprüfung von klinischen Prüfpräparaten spezialisiert.
Dr. Silke Sommer
WHAT’S NEXT, SILKE SOMMER - HEAVY METAL
Zwei Zangen halten an der Universalprüfmaschine im Technikum des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM eine neue Schweißverbindung in extremer Spannung. Ein Display zeigt Informationen zum Versuchsverlauf an. Wann bricht die Probe? Und auf welche Weise? An ihrer Oberfläche ist die Schweißverbindungsprobe fein gesprenkelt. Von der Prüfmaschine wurde sie langsam gedehnt – jetzt bricht sie mit einem trockenen »Klack!«. Silke Sommer beugt sich zur Maschine und baut die Probe aus. »Das Sprenkelmuster hilft uns bei der optischen Messung der Dehnung. Wie hoch ist voraussichtliche die Tragfähigkeit eines geschweißten Bauteils im Auto oder Bahnwaggon? Das können wir exakt berechnen.«
Wenn Silke Sommer von ihrem Bereich der Fügeverbindungen, von Schädigungsmechanik, Crash-Sicherheit und Werkstoffmechanik spricht, dann liegt Begeisterung in ihrer Stimme. Was auch am Tonfall der Physikerin liegen mag: Silke Sommer wuchs am Kaiserstuhl auf - unweit des Instituts in Freiburg - und genau das hört man mit jedem Satz. »In unserem Technikum wird der jeweils neue Werkstoff-Verbund aus Stahl, Aluminium und beispielsweise Klebstoffen auf seine grundlegenden mechanischen Eigenschaften hin getestet.« Gemeinsam mit einem jungen Doktoranden sichtet die Gruppenleiterin am Rechner erste Ergebnisse von Werkstofftests und den zugehörigen Simulationen. »Wir bewerten die Sicherheit: Wie verhält sich der Werkstoff, wenn er vorgeschädigt wurde? Die Nachfrage ist enorm nach solchen Tests, die in der Regel weit vor den klassischen Crashtests am fertigen Produkt greifen und diese bisweilen sogar überflüssig machen. Zu den Kunden von Sommers Gruppen gehören die großen Unternehmen der Automobilindustrie, die immer wieder mit neuen, leichten Materialkombinationen experimentieren – schließlich gilt es, durch Leichtbau Gewicht und somit den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber auch kleinere Unternehmen lassen hier testen, wie etwa Hersteller von Bohrern, die mit neuen Fügetechnologien arbeiten. »Wo lassen sich problemlos Verbindungen setzen? Welche Eigenschaften haben diese? Wir ziehen, tordieren und drücken in Experiment und Simulation. Am Ende wissen wir genau, wie sich das Produkt verhalten wird, erläutert Silke Sommer.
An ihrem Arbeitsplatz zeigt uns die Forscherin, die sich seit knapp 20 Jahren auch mit IT und numerischer Simulation beschäftigt, ein von ihr entwickeltes Computerprogramm. »Hier modellieren wir die Verbindungen.« Routiniert tippt Sommer Ergebnisse aus dem Versuch am Vormittag ein. »Mit unseren Berechnungen und Methoden sparen Auftraggeber enorme Kosten«, bekräftigt sie, denn selbstverständlich sei es effizienter, die Charakteristika eines Bauteils durch Simulation zu prüfen als durch viele aufwendige Tests mit echten Prototypen. So würde kein Zug mit 110 km/h in Realität gegen einen auf einem Bahnübergang stehenden Laster gefahren: »Dieses Szenario wird nur virtuell getestet!«
Mit kritischem Blick wertet die Forscherin ihr Datenpaket nun aus; die geschweißte Probe vom Vormittag hat sich nicht wie erwartet verhalten. Mit ungebremstem Elan erläutert Silke Sommer weiter die Vorteile dieses Vorgehens: Durch die enge Verknüpfung von Simulationsmethoden mit experimentellen Untersuchungen ist es ihren Gruppen möglich, das mechanische Verhalten von Werkstoffen und kompletten Bauteilen vorherzusagen.
Apropos Gruppe: »Gemischte Teams sind besser in Balance und arbeiten innovativer und harmonischer zusammen«, ist sich Silke Sommer sicher. Deshalb wünscht sich die Simulations-Expertin für die Fraunhofer-Gesellschaft zukünftig mehr Frauen in Führungspositionen, gerade im wissenschaftlich-technischen Bereich. Am Ende des Tages greift Silke Sommer zur Sporttasche und macht sich auf in Richtung eines nahe gelegenen Sees. »Hier gleite ich mit meinem Stand-Up-Paddle-Board ganz in Ruhe über eine spiegelglatte Fläche und lasse die Gedanken schweifen«, sagt sie strahlend und lässt so ihren herausfordernden Tag vor Prüfmaschinen und Computersimulationen nochmals Revue passieren. Wenn man die Wissenschaftlerin Anfang August nicht auf diesem See findet, dann vielleicht beim Wacken-Festival, denn (Schwer-)Metall ist nun mal ihre Leidenschaft, auch in musikalischer Hinsicht. »Hier wie da finde ich meine eigene Balance – entweder ganz von selbst auf meinem SUP-Board – oder, wenn Heavy Metal durch meinen Kopf rauscht.«
Dr. Silke Sommer ist Werkstoff-Expertin: Wer die Gruppenleiterin am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg einen Tag lang begleitet, erfährt, warum sich der Bereich Mobilität über Innovationen aus dem Fraunhofer IWM freut, warum es wichtig ist, in Führungspositionen eine Balance zu finden – und, dass (Schwer-)Metall nicht nur beruflich faszinierend sein kann.
Prof. Dr.-Ing. Iman Taha
»Die Zukunft lernt von Nussschokolade!«
Prof. Dr.-Ing. Iman Taha leitet die Abteilung Materialien und Prüftechnik an der Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV in Augsburg. Im Interview spricht sie über die Materialien der Zukunft, über das große Plus der Fraunhofer-Gesellschaft – und über die Lebenszyklen von Produkten.
Was zeichnet die Fraunhofer-Gesellschaft für Sie aus?
Für mich ist die Fraunhofer-Gesellschaft das deutsche Plus in der Forschungslandschaft. Im Ausland existiert keine vergleichbare Institution! Hier kann ich mich frei entfalten, kreative Ideen erarbeiten und fortführen.
Welche kreativen Ideen verfolgen Sie derzeit in Ihrem Forschungsbereich?
Unsere Überlegungen gehen immer in Richtung neuer Materialien. Denken wir an die moderne Mobilität. Wir wollen Sicherheit, Geschwindigkeit und Komfort, aber auch Effizienz, Umwelt- und Klimafreundlichkeit. Mit Blick auf den Leichtbau geht es also unter anderem um Materialien, die leicht, aber dennoch fest sind – beispielsweise carbonfaserverstärkte Kunststoffe oder Faserverbundwerkstoffe. Als Mischwerkstoffe bestehen Letztere aus zwei Komponenten: den Fasern und dem Binder- oder Klebstoff dazwischen. Durch die Wechselwirkungen entstehen im Verbund neue, bessere Eigenschaften.
Zum Beispiel?
Bricht man ein Stück Nussschokolade ab, kann die Bruchstelle schwer durch die Nuss verlaufen, weil sie »fester« ist als die umgebende Schokolade. Unsere Fasern funktionieren ganz ähnlich: Sie verstärken den Kunststoff.
Wo werden Faserverbundwerkstoffe eingesetzt?
Neben dem Automobilbau sind die Luftfahrt und der Maschinen- und Anlagenbau wichtige Anwendungsbereiche. Überall haben wir es mit sich bewegenden Teilen zu tun, die schneller und leichter werden sollen. Im Airbus A350 sind heute über 50 Gewichtsprozent Faserverbundwerkstoffe verbaut. Der Airbus kann deshalb mehr Passagiere und Lasten transportieren und ist dabei effizienter als seine Vorgänger.
Klingt gut. Womit könnte die Fraunhofer-Gesellschaft die Welt zukünftig noch ein bisschen besser machen?
Ich frage mich, was wir mit unserem Müll machen. Schrott in Drittländern zu deponieren kann nicht die Lösung sein. Wir müssen uns deshalb nicht nur darüber Gedanken machen, welche Materialien wir verbauen, sondern auch, wie wir sie später wiederverwerten.
Prof. Dr.-Ing. Iman Taha ist gebürtige Düsseldorferin und kam im Vorschulalter mit ihren Eltern nach Ägypten, wo sie, nach dem Abitur an einer deutschen Schule, Maschinenbau studierte. Nach der Promotion an der TU Clausthal zum Thema naturfaserverstärkte und Verbundwerkstoffe hatte sie eine Professur am Lehrstuhl Konstruktion und Fertigungstechnik an der Ain Shams University in Kairo inne. Heute leitet Taha die Abteilung Materialien und Prüftechnik an der Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV in Augsburg.
Prof. Mario Trapp
WHAT’S NEXT, MARIO TRAPP - WAS AUTONOMES FAHREN SICHER MACHT
Die Zukunft, sie kommt leise, dezent daher. Wer Prof. Mario Trapp besuchen will, der betritt erst einmal den Sicherheitsbereich des Fraunhofer IKS in der Münchner Hansastraße. Hier herrscht die Ruhe konzentrierten Arbeitens. Unter Laborbedingungen werden Cloud-Anwendungen auf Verlässlichkeit geprüft; zwei junge Ingenieure analysieren Sensornetzwerke. Die Tür steht offen zu einem bescheidenen Nebenraum, dem Büro des Institutsleiters Trapp. Der Sicherheitsexperte wird von Branchenkennern zu den renommiertesten Vordenkern gezählt, wenn es um die Verlässlichkeit von Softwaresys-temen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren geht.
Das Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS forscht und entwickelt an einem der relevantesten Zukunftsthemen überhaupt: der Verlässlichkeit von Künstlicher Intelligenz. Die Nachfrage ist hier immens, hängt die Marktreife selbstfahrender Autos doch entscheidend von der Sicherheit der KI ab, mit der sie gesteuert werden. Und Mario Trapp spielt in diesem Bereich in der Champions League.
»Menschen werden Fehler eher verziehen als Maschinen«, sagt Trapp. Verlässliche Technik müsse mindestens um den Faktor 10 besser sein als der Mensch – eher um den Faktor 100. »Beim autonomen Fahren können wir erst zufrieden sein, wenn die Wahr-scheinlichkeit für einen Fehler mit Todesfolge im Bereich von einem Billionstel liegt – also nicht bei 99,9 Prozent, sondern über die neunte Nachkommastelle hinaus.«
Die Herausforderung: Künstliche Intelligenz basiert zumeist auf neuronalen Netzen. Wie ihre Vorbilder, die biologischen neuronalen Netze des menschlichen Gehirns, sind ihre Entscheidungen keineswegs durchgängig mathematisch herleitbar. Die Lösung: eine Algorithmik, die Künstliche Intelligenz absichert – ohne ihre Performance einzuschränken. Das Fraunhofer IKSarbeitet mit Hochdruck daran. »Momentan liegt die Betonung bei Künstlicher Intelligenz noch auf künstlich. Nicht auf Intelligenz«, führt Trapp aus. Seine Vision für die Zukunft: Deutsche Ingenieurstradition mit dem »Trainieren« von Software so verbinden, dass KI-Systeme verlässlich funktionieren, dass Unerwartetes aufgefangen, ja kontrolliert werden kann.
An einem Whiteboard im Labor diskutiert Mario Trapp am frühen Nachmittag mit einem Team aus Wissenschaft und Technik Berechnungen zur Trajektorie, also zur Kalkulierbarkeit von Bewegungspfaden. Trapp, der 2005 mit Auszeichnung an der TU Kaiserslautern promovierte und 2016 habilitierte, verantwortete bereits am Fraunhofer–Institut für Experimentelles Software Engineering IESE das Themengebiet sicherheitskriti-sche Software, wurde dann Hauptabteilungsleiter »Embedded Systems« und schließlich geschäftsführender Leiter des Fraunhofer IKS. Wie ist er eigentlich zum Thema Sicherheit gekommen? »Ein einschneidendes Erlebnis war eine Probefahrt mit dem Vorstand von Bosch, bei dem es zum Totalausfall der Software kam«, erinnert sich der Informatiker. »Mir wurde klar, wie wichtig verlässliche Software ist. Leider haben deutsche Unternehmen dieses Thema spät erkannt.« Heute hat der Sicherheitsexperte nicht nur das einzelne Fahrzeug, sondern auch die Sicherheit ganzer Systeme im Blick; im Fall eines Brandes, eines Notarzt- oder Polizeieinsatzes muss die Sicherheitsarchitektur einer ganzen Stadt »smart« und verlässlich funktionieren.
Zunächst aber werden es wohl Busse oder Lkw mit eingeschränkter Geschwindigkeit sein, die als selbstfahrende Autos das Stadtbild verändern. »Das autonome Auto, das mit 250 Stundenkilometern durch Tokio fährt, werde ich vor meinem Ruhestand nicht erleben«, meint Trapp. Bis zu seinem letzten Arbeitstag dauert es glücklicherweise noch eine ganze Weile. Jahre, in denen das Fraunhofer IKS mit Partnern wie etwa Intel einen relevanten Beitrag zur Sicherheit von Software beitragen wird. Der deutschen Automo-bilindustrie rät Trapp derweil zu mehr Wachsamkeit, gepaart mit einer Prise Mut. Die einschlägigen Mobilitätstrends seien in den letzten Jahren gesamtheitlich verschlafen worden. »Ein amerikanischer Informatiker blickt heute auf deutsche Autos wie ein Maschinenbauingenieur auf einen Trabbi. Verbraucher haben gelernt, dass sie auf ihr Handy jedes Jahr eine neue Software aufspielen können. Ähnliches ist bei manchen E-Autos heute möglich. Bei deutschen Fabrikaten nicht!«
Damit die deutsche Freude am Fahren Zukunft hat, plädiert Professor Trapp für intelligente Mobilitätslösungen, die mehr in Diensten als in Fahrzeugen gedacht sind. Sonst könnte die Zukunft alles andere als modern aussehen: »Was wir brauchen, ist ein funktionierendes Gesamtsystem, in dem die einzelnen vernetzten Systeme des Stadtverkehrs ihre eigene sicherheitskritische Funktionsfähigkeit jederzeit sicherstellen. Der Blick darf dabei nicht mehr nur auf den einzelnen Menschen oder das einzelne Auto gehen. Wir müssen in komplexen Sicherheitsarchitekturen denken, wenn wir den Anschluss nicht verpassen wollen.« Mit diesen Worten macht sich Mario Trapp auf in Richtung Museum Fünf Kontinente: Der Neu-Münchner will sich die Joseph-von-Fraunhofer-Statue anschauen, die seitlich, leicht versteckt vor dessen Eingang steht. Welches Verkehrsmittel er hierzu nimmt? Es ist, ganz unspektakulär, die Münchner S-Bahn. Manchmal kommt die Zukunft eben leise daher, dezent.Prof. Mario Trapp ist geschäftsführender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik IKS in München, das gerade zum Institut für Kognitive Systeme ausgebaut wird. Wer ihn einen Tag lang begleitet, bekommt eine Ahnung, wie viel Pionierarbeit noch nötig sein wird, um autonomes Fahren wirklich sicher zu machen – und worin echte Chancen für die deutsche Automobilindustrie bestehen.
Prof. Mario Trapp ist geschäftsführender Leiter des Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS in München, das gerade zum Institut für Kognitive Systeme ausgebaut wird. Wer ihn einen Tag lang begleitet, bekommt eine Ahnung, wie viel Pionierarbeit noch nötig sein wird, um autonomes Fahren wirklich sicher zu machen – und worin echte Chancen für die deutsche Automobilindustrie bestehen.
Gerd Unkelbach
WHAT’S NEXT, GERD UNKELBACH: DIE CHEMIE STIMMT
Vom Chemielaboranten zum Bioökonom: Diplomchemiker Gerd Unkelbach leitet das Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP. Mit seinen Teams skaliert er Verfahren zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe in produktionsrelevante Dimensionen – und beschleunigt so Verfahrensentwicklungen. Die Mission des 40-jährigen Forschers: mehr Biotechnologie und nachwachsende Rohstoffe in den chemischen Kontext einbringen – zusammen mit der chemischen Industrie, nicht gegen sie. Ein Ortstermin.
»Wir werden Erdöl ersetzen – und das in absehbarer Zeit!« Gerd Unkelbach steht in einer Zucht-Station für Mikroalgen. In der europaweit einzigartigen Multifunktionsanlage zur Entwicklung und Skalierung von Bioraffinerieverfahren erklärt der Leiter des Fraunhofer CBP: »Damit wir aus nachwachsenden Rohstoffen chemische Grundstoffe herstellen können, brauchen wir dringend neue Verfahren. Es gilt, das Beste aus Biotechnologie und Chemie zusammenzubringen. Wir sorgen dafür, dass die Prozesse, die im Labor schon klappen, künftig auch im industriellen Maßstab funktionieren werden.«
Gerd Unkelbach verdeutlicht die Dringlichkeit. »Kunststoffe, Lacke, Klebstoffe. Das alles wird nach wie vor größtenteils aus Erdöl hergestellt. Aber mit regenerativen Rohstoffen können wir nicht nur die Abhängigkeit vom Erdöl reduzieren, wir können auch die CO2-Emissionen insgesamt verringern.« Daher arbeiten seine Teams aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Laborantinnen und Laboranten hier in Leuna in Sachsen-Anhalt an Prozessen, die rohstoff- und energieeffizienter sind als traditionelle petrochemische Verfahren. Immerhin stellt das Fraunhofer CBP eine europaweit einzigartige Plattform zur Entwicklung solcher Verfahren dar – mit direkter Anbindung an die chemische Industrie. Ausgearbeitet und vorangetrieben wurde es vor 2009 unter dem Arbeitstitel Chemisch-Biotechnologisches Prozesszentrum vom Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB und vom Pfinztaler Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT. 2012 erfolgte die Eröffnung, und das Fraunhofer CBP wuchs schnell von 19 auf über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.
»Was ich spannend an meiner Arbeit finde?« Gerd Unkelbach rückt kurz seine Brille zurecht. »Die Suche nach Alternativen zu endlichen fossilen Rohstoffen wie Erdöl ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit!« Hier an einer Lösung arbeiten zu können sei nur mit, nicht gegen die chemische Industrie möglich – einem wichtigen und innovativen Player im wirtschaftlichen Ökosystem Europas.
Von den Mikroalgen führt Unkelbachs Weg zu einem Container mit Holzrückständen, vorbei an den großformatigen Sonnenschutzlamellen des Hauptgebäudes. Hier riecht es besonders stark nach frischem Holz: » Wir arbeiten daran, neue Aufschlussverfahren mit wenig genutzten Arten wie Buchenholz zu finden – und das mit anderen Lösungsmitteln als bei der Herstellung von Zellstoff und Papier.« Gerd Unkelbach gehört zu den maßgebenden Treibern einer neuen Bioökonomie. Fünf Prozessanlagen stehen für ihn und seine Teams auf dem Gelände bereit; sie können modular, separat oder miteinander betrieben werden. »Wir kombinieren hier Verfahren auf Basis von Pflanzenöl, Lignin, Cellulose, Stärke und zuckerhaltigen Rohstoffen«, erklärt Unkelbach. So sei es bereits gelungen, aus Holzhackschnitzeln, Rinde und Pflanzenresten das Zwischenprodukt Organosolv-Lignin zu isolieren, das als Bindemittel in Faserplatten Formaldehydharze oder als Werkstoff generell Kunststoffe ersetzen kann. Am Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT begann Gerd Unkelbach übrigens als technischer Mitarbeiter; dann folgte der Wechsel nach Leuna. Die chemische Industrie hat der 40-Jährige von einer sehr positiven Seite kennengelernt: »Natürlich brauchen wir mehr Biotechnologie im chemischen Kontext. Aber unsere Kunden sind bereits heute sehr aufgeschlossen. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, sind sie weit vorn.« Immerhin hänge auch die Wirtschaftskraft Europas in nicht unerheblichem Maße von der chemischen Industrie ab. Unkelbach rechnet vor, dass das »Gesamtsystem chemische Industrie« in Deutschland fast 2 000 Firmen und mehr als 460 000 Arbeitsplätze umfasst. »Da gilt es den Wandel bejahend zu bleiten – und zu gestalten.«
Die Wissensvermittlung ist eine Herzensangelegenheit von Gerd Unkelbach. »Wir reden immer noch zu wenig, und genau das führt zu einem undifferenzierten Bild. Für viele Menschen steht Chemie ja leider für etwas Schädliches. Aber Chemie ist nicht unser Feind. Ganz im Gegenteil: Chemie geht uns alle an!« Und schon ist der Chemiker und Bioökonom in einem seiner Technika verschwunden..
Dr. Angi Voß
»Intelligente Systeme werden unser Leben immer mehr vereinfachen!«
Dr. Angi Voß ist Informatikerin am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin und gehört zu den führenden Fraunhofer-Köpfen im Bereich Künstliche Intelligenz. Sie beschäftigt sich mit den Themen Big Data und Data Science. Ihre Antwort auf die Zukunftsfrage: Weiterbildung und Wissenstransfer.
Sie sind KI-Expertin. Was ist Ihre Vorstellung von der Zukunft?
Mich treibt der Klimawandel um. Wenn wir unseren Planeten nicht mehr bewohnen können, wird auch KI egal sein. Davon abgesehen hängt eine erfolgreiche KI-Zukunft von ihrem Image ab. Als sehr medienwirksames Thema ist sie mit vielen Ängsten verknüpft. Es gibt dieses »Gespenst KI« in den Köpfen. Und dann gibt es da noch die Prognosen, dass soundso viele Arbeitsplätze verloren gingen. Fakt ist aber: Die Menschen, die heute schon mit intelligenten Systemen arbeiten, haben keine Angst, ihren Job zu verlieren.
Wir sprechen also davon, dass KI zwar Routinearbeit automatisiert, den Menschen aber nicht ersetzen wird. Würden Sie sagen, KI erleichtert auch das Leben?
Absolut! Die moderne Sprach- und Bildverarbeitung macht unser aller Leben bequemer. In der Medizin unterstützen digitale Assistenten die Diagnose. Krankheiten werden zuverlässiger und schneller erkannt. Ich möchte unbedingt, dass meine Ärzte demnächst Fach-KIs hinzuziehen. Mithilfe intelligenter Dialogsysteme müssen wir immer seltener tippen, sondern können einfach mit Maschinen reden.
Eine Zukunft, die sehr greifbar ist. Zumal das Fraunhofer IAIS bereits Prototypen sprachgesteuerter Dialogsysteme im Einsatz hat. Aber wie sieht denn Ihre ganz persönliche Arbeit heute und in Zukunft aus?
Meine wichtigste aktuelle Aufgabe ist die Initiative KI.NRW. Wir haben einen Prüfkatalog entwickelt, um KI zu zertifizieren. Also: vertrauenswürdige KI, die in Wirtschaft und Industrie funktioniert. Aufklärung und Information sind extrem wichtig. Deshalb setze ich persönlich auf Weiterbildung und Wissenstransfer. Vor diesem Hintergrund haben wir zusammen mit anderen Instituten beispielsweise das Schulungsprogramm zum Data Scientist schon sehr früh aufgebaut und aktualisieren es ständig.
Dr. Peter Zeller
»Zukunft braucht Entscheidungssicherheit!«
Dr. Peter Zeller ist Vorstandsmitglied des Fraunhofer-Alumni e. V., eines fachübergreifenden Netzwerks ausgezeichneter Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Die Frage #WHATSNEXT beantwortet der Unternehmensberater mit Strategiekompetenz: Die große Herausforderung der Zukunft liegt für ihn in einem besseren Austausch von Wissenschaft und Politik.
Warum engagieren Sie sich als Fraunhofer-Alumnus?
Ziel der Fraunhofer-Alumni e.V. ist es, nicht nur Informationen über ehemalige Institute, sondern auch Jobangebote, Veranstaltungshinweise und einzigartige Vernetzungsmöglichkeiten anzubieten. Jedem engagierten Fraunhofer-Alumnus sollte ein fachübergreifendes Netzwerk in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik offenstehen – womit wir auch schon bei einem meiner wichtigsten Anliegen wären, dem Austausch genau dieser Bereiche.
Liegt dieses Thema sozusagen in der »Fraunhofer-DNA«?
Zu Recht ist Fraunhofer geprägt durch die vielen Unternehmensgründungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier zeigt sich, wie Forschung Wirtschaft und Gesellschaft positiv beeinflusst. Die Marke Fraunhofer hat ja einen hervorragenden Ruf – und das nicht nur europaweit.
Was braucht die Fraunhofer-Gesellschaft noch, um auch zukünftig exzellent aufgestellt zu sein?
Ich freue mich, dass Fraunhofer wirklich sichtbar ist und sich in die relevanten Diskurse unserer Zeit einbringt. Aber auch die besten Wissenschaftler können die Gesellschaft nicht im Alleingang nach vorne bringen. Grundvoraussetzung ist, dass die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Es ist an der Zeit, dass sich die Regierungen Europas einig sind, wohin die Reise gehen soll. Erst wenn es klare Zielvorgaben, wenn es einen roten Faden gibt, kann unsere Zukunft konstruktiv gestaltet werden. Im Kleinen fängt das Unkalkulierbare, die fehlende Steuerung der Zukunft schon bei ganz alltäglichen Fragen wie beispielsweise dem Heizungskauf an. Niemand kann sagen, welche Art der Wärmeerzeugung auch morgen noch wirtschaftlich und zulässig ist. Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure sind dazu da, hier valide Vorschläge zu machen. Die Politik muss dann aber auch darauf eingehen, sie muss Entscheidungen treffen. Nur so können wir Entscheidungssicherheit für die Zukunft erzeugen!
Dr. Peter Zeller hat nach der Ausbildung zum technischen Zeichner und einem Maschinenbaustudium in Paderborn, Oxford und Aachen 1983 am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT in Aachen zunächst als studentische Hilfskraft, später als Assistent und Oberingenieur gearbeitet. Seit 2016 ist er Vorstandsmitglied des Fraunhofer-Alumni e. V. Zeller engagiert sich darüber hinaus als Experte und Mentor für junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Er führte viele Jahre lang namhafte Unternehmen als CEO und ist heute Inhaber der Dr. Zeller Management Consulting.
![]()