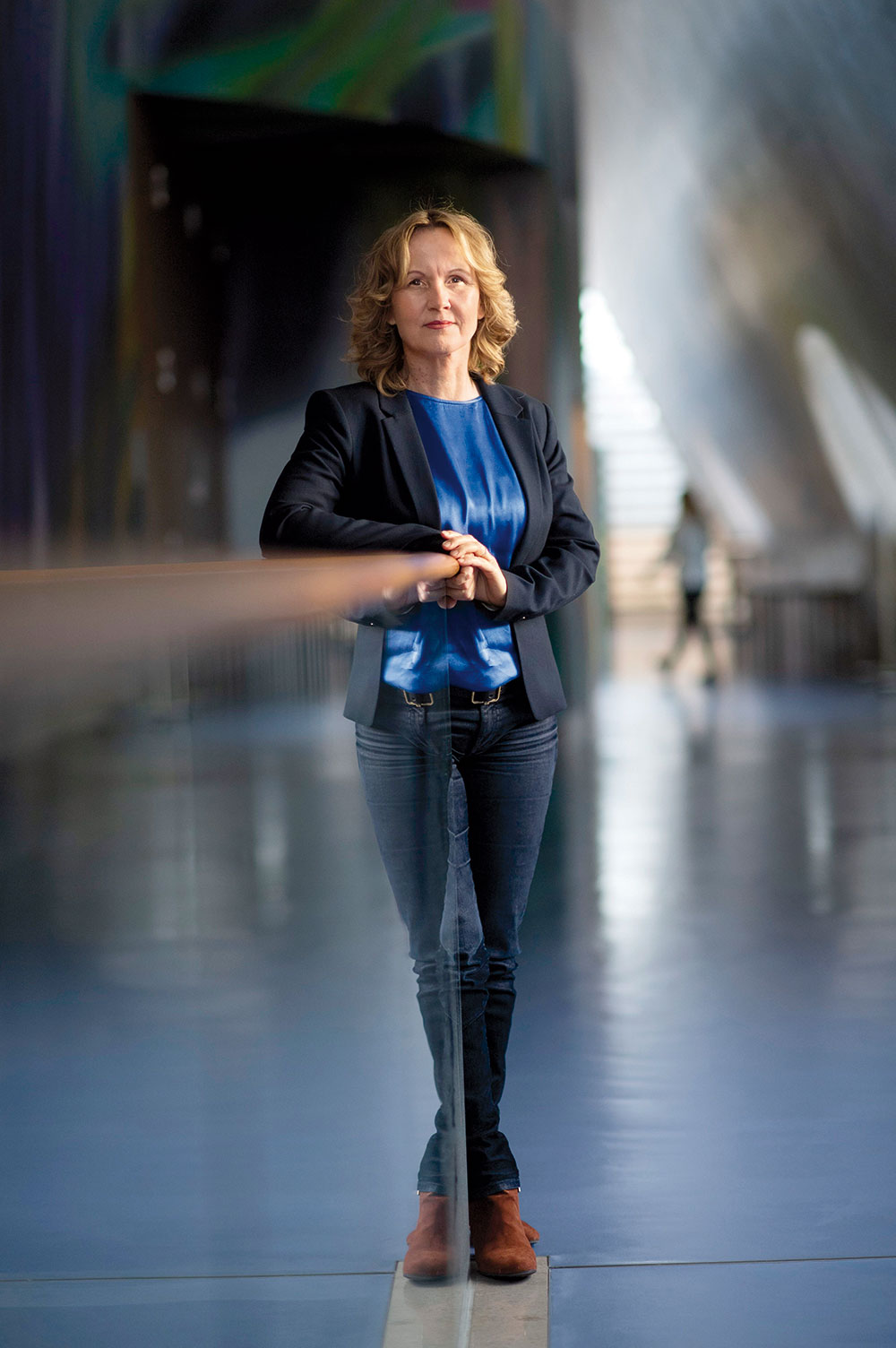Abwasser, das schnell weggeleitet werden soll, ist ein geläufiger Begriff. Werden wir immer häufiger auch Zuwasser brauchen, um über Fernleitungen vermehrt Wasser aus nassen Regionen in Deutschlands Trockengebiete zu bringen?
Der Grundsatz einer möglichst ortsnahen Wasserversorgung gilt auch in Zukunft. Dafür müssen wir unsere Wasserversorgung besser vernetzen. Ergänzend werden aber auch in bestimmten Fällen Verbundnetze oder Fernleitungen nötig sein, die regionale Unterschiede bei der Verfügbarkeit von Wasser ausgleichen. Zunächst werden wir gemeinsam mit den Ländern den tatsächlichen Bedarf für solche Systeme bundesweit erheben.
Warum eigentlich tut sich grüne Politik gerade in Ostdeutschland so schwer, Zustimmung bei Wählern zu finden?
Diese Einschätzung teile ich nur begrenzt. Wir regieren schließlich in drei von fünf der neuen Bundesländer sehr erfolgreich mit. Gleichzeitig sehe ich auch, dass wir besser werden müssen. Die Menschen in Ostdeutschland haben eine große Lebensleistung erbracht: Sie haben sich Freiheit und Demokratie selbst erkämpft. Die meisten mussten danach ihr Leben innerhalb kurzer Zeit ziemlich umkrempeln, sehr viele erlebten Arbeitslosigkeit, bekamen westdeutsche Chefs, ein großer Teil meiner Generation ist in den Westen abgewandert. Diese Erfahrungen haben wir als Grüne, aber auch wir als Gesellschaft bisher zu wenig berücksichtigt.
Ist grüne Politik heute zu einer Politik für Besserverdienende geworden, die sich nicht um Kosten für Wärmepumpen, Solaranlagen und Isolierungsmaßnahmen sorgen müssen?
Das Gegenteil ist der Fall: Möglicherweise erscheint Ihnen das paradox, aber die Grünen haben schon immer Politik für Gruppen gemacht, die – noch – keine Lobby haben. Das sind junge Menschen und zukünftige Generationen, die noch keine Stimme haben. Und das sind auch Menschen, die unter der Klimakrise und Umweltverschmutzung besonders leiden: ältere Menschen, Menschen in kleinen, schlecht isolierten Wohnungen ohne Balkon oder Garten, Menschen, die an den besonders stark befahrenen Straßen wohnen, und Menschen, denen es schwerfällt, die steigenden Energiepreise aufgrund des russischen Angriffskrieges und der fossilen Energiekrise zu bezahlen. Deshalb setzen wir uns für eine vorausschauende, sozial ausgewogene Politik mit gestaffelter Förderung und Schutz für die Mieterinnen und Mieter ein. Gerade das Festhalten an fossilen Heizungen würde viele Menschen in eine Kostenfalle treiben.
Können Sie als Umweltministerin privat noch ein Leben führen, das zu einer Umweltschützerin passt?
Privat gelingt mir das ganz gut. Ich wohne weiterhin in Dessau und genieße die kurzen Wege in die Natur. Von Dessau nach Berlin pendle ich meist mit der Bahn.
Wie gehen Sie selbst mit dem Thema Verpackungen um?
Ich versuche, so gut es geht, unnötige Verpackungen einzusparen. Ich nutze für den täglichen Gebrauch meine Mehrwegflasche, die ich mit Leitungswasser fülle. So bin ich selbst auf Reisen nicht auf Flaschen aus Einwegplastik angewiesen. Auch in meinem Büro gibt es Wasser aus der Karaffe. Zum Einkaufen nehme ich meinen Rucksack oder eine Tasche mit.
Die weltweite Plastikherstellung hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Sie haben im Juni in Paris auf einer UN-Konferenz mit 175 Staaten darauf gedrängt, die Produktion einzudämmen. Ist das der Weg: Recycling plus Reduktion?
Die Plastikverschmutzung hat weltweit ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Ohne konzertierte globale Maßnahmen und einen international verbindlichen Rahmen wird die Verschmutzung weiter zunehmen. Im Moment handeln die UN-Mitgliedsstaaten ein rechtsverbindliches Abkommen gegen Plastikmüll aus, das 2025 unterzeichnet werden soll. Darüber bin ich sehr froh, ich setze mich mit aller Kraft für dieses Abkommen ein. Alle Kunststoffe bestehen aus Chemikalien, die potenziell gefährlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sein können. 2022 hat sich Deutschland einer Gruppe ambitionierter Staaten angeschlossen, die sich für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen stark macht. Wir wollen Kunststoffproduktion und -verwendung nachhaltig gestalten, weltweit eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe aufbauen und den umweltverträglichen Umgang mit Kunststoffabfällen sicherstellen. Kurzum: Besseres Recycling ist weltweit wichtig, wir können der Plastikverschmutzung aber nicht nur mit Recycling begegnen.
Welche Hindernisse sehen Sie international?
Der Weg zu einem globalen Abkommen gegen Plastikmüll ist voller Herausforderungen: Mehr als 1650 Teilnehmende aus 169 Ländern und der EU sowie über 300 Beobachterorganisationen, zudem eine extrem knappe Fristsetzung – ein Verhandlungsprozess dieser Dimension stellt schon rein formal extreme Anforderungen. Ich bin sehr froh, dass die Verhandler in der zweiten Verhandlungsrunde (INC 2) in Paris ihre Fähigkeit bewiesen haben, auch in der Sache gemeinsame Ergebnisse im Konsens zu erzielen. Zu den erwarteten inhaltlichen Knackpunkten zählen der Grad der Verbindlichkeit einzelner Maßnahmen des Abkommens, die Auslegung und Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung, die Frage einer möglichen Beschränkung der Plastikproduktion sowie die Frage der Finanzierung.
Welche Maßnahmen sind die dringlichsten?
Unsere Meere sind für das Klimasystem von zentraler Bedeutung. Sie sind Orte überragender Biodiversität, sie sind Nahrungsquelle und derzeit massiv mit Plastikmüll verschmutzt. Dabei ist der nicht nachhaltige Umgang mit kurzlebigen Verpackungen, die über die Gewässer in die Meere gelangen, eines der Hauptprobleme. Das internationale Abkommen zur Reduzierung der Plastikprobleme muss ein globaler Schlüssel zur Lösung zahlreicher Herausforderungen werden. Materiell halte ich strenge globale Verpflichtungen, die für alle Länder gelten sollten, für unabdingbar. Der Schwerpunkt zu ergreifender Maßnahmen sollte am Beginn und in der Mitte des Lebenszyklus etwa auf nachhaltige Produktion und Konsum, Produktdesign und Steigerung der Zirkularität gelegt werden. Und: Wir müssen weltweite Kapazitäten aufbauen, die für eine echte Kreislaufwirtschaft erforderlich sind. Hierzu müssen z. B. international agierende Konzerne, die weltweit ihre Produkte in Plastikverpackungen vermarkten, zunehmend viel stärker in die Pflicht genommen werden. Sie müssen gewährleisten, dass ihre Verpackungen nicht nach dem Gebrauch im Meer landen.
Zahlreiche Fraunhofer-Teams arbeiten daran, Kunststoffe länger nutzbar zu machen, das Recycling zu verbessern, biobasierte Alternativmaterialien zu entwickeln. Wo kann die Forschung Sie unterstützen?
Wir brauchen noch mehr Forschung, um insgesamt den Umgang mit Kunststoffen nachhaltiger zu machen. Biobasierte Alternativen dürfen nicht zu Lasten der Nahrungsmittelproduktion oder der Biodiversität gehen. Deshalb sehe ich hier einen Schwerpunkt bei der möglichen Verwendung von Nebenprodukten aus der Landwirtschaft, die ansonsten nicht hochwertig genutzt werden können. Beim Recycling sehe ich bei Rezyklatqualität, Tracer- und Sortiertechnologien sowie der Bewertung alternativer Verfahren wichtige Optimierungspotenziale. Auch bei den viel diskutierten chemischen Zerlegungsverfahren sehe ich großen Forschungsbedarf, sowohl in technologischer Hinsicht wie auch bezüglich der Bewertung der Effizienz als auch der Energie- und Schadstoffbilanz.
Wie können Politik und Forschung die Zusammenarbeit so ausbauen, dass Lösungsansätze der Wissenschaft schneller in die Umsetzung kommen?
Zum Beispiel durch das direkte Gespräch. Ohne die unabhängige Forschung der Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft wäre eine wissens- und faktenbasierte Politik gar nicht möglich. Die Leistungen der Forscherinnen und Wissenschaftler sind nicht hoch genug zu würdigen. Wir sind gut beraten, dieses Angebot auch zu nutzen und für die eigene Politik zu berücksichtigen.
Was halten Sie vom Begriff »Technologieoffenheit«: Ist das für Sie ein Feigenblatt, um die Industrie zu schützen, oder tatsächlich der Weg, um Zukunftsprobleme zu lösen?
Gegen den Begriff habe ich nichts. Leider wird er aber allzu oft missbraucht, um veraltete, teure, ineffiziente oder auf absehbare Zeit nicht bezahlbare Technologien in der Debatte und damit am Leben zu halten. Das ist oft nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, wird aber als vermeintliche Freiheit verkauft. Wohlverstanden würde dieser Begriff dazu führen, dass sich diejenige Technologie durchsetzen soll, die am besten bei der Erreichung unserer Klimaschutzziele hilft, zugleich am wirtschaftlichsten ist und keine anderen ökologischen Probleme auslöst. Echte Technologieoffenheit braucht daher auch einen Realitätscheck und eine seriöse Technikfolgenabschätzung.
Klima, Krieg – und dann lange nichts: Vermissen Sie die Aufmerksamkeit für all die anderen Umweltthemen?
Auf keinen Fall. Die Welt ist ja deutlich komplexer, als es so manche Zuspitzung in der Debatte vermuten lässt. Die Klimakrise gefährdet auch unsere Ökosysteme. Gleichzeitig leisten diese im Sinne eines natürlichen Klimaschutzes einen großen Beitrag zur Lösung. Und leider führt auch der Krieg in der Ukraine zu massiven Umweltbelastungen, die die Menschen vor Ort bereits spüren: verseuchte Böden, Luftverschmutzung, Kontamination von Wasser, z.B. durch die Sprengung des Kachowka-Staudammes. Und über allem schwebt die Gefahr einer nuklearen Katastrophe im AKW Saporischschja.
Die Probleme sind groß, Ihr Etat im Bundesumweltministerium gehört mit 2,4 Milliarden Euro zu den kleinsten. Spart Bundesfinanzminister Christian Lindner am falschen Platz?
Der Kernhaushalt des Bundesumweltministeriums ist als einer der wenigen nahezu konstant geblieben. Das ist ein gutes Zeichen, wenn überall sonst teils drastisch gespart werden muss. Gleichzeitig steht für den Natürlichen Klimaschutz mit vier Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bis 2026 so viel Geld zur Verfügung wie noch nie.
Der Natürliche Klimaschutz gilt als Ihr größtes Projekt. Diesen Sommer sollten erste Maßnahmen starten: Was geht voran?
Wir sind Mitte Juli mit den ersten beiden Förderrichtlinien zum Natürlichen Klimaschutz in ländlichen Räumen und in Unternehmen gestartet. Damit erreichen wir eine wichtige Bandbreite an Akteuren, um die Klimaschutzfunktion der Natur wiederherzustellen und sie besser zu bewahren. Weitere Förderrichtlinien werden sich in den nächsten Monaten anschließen, um CO2 bzw. Kohlenstoff in Mooren, Auen oder Wäldern zu speichern. Außerdem wird im Oktober das Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz an den Start gehen, um die schnelle und wirksame Umsetzung der Fördermaßnahmen aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz in der Fläche zu unterstützen.
Sie haben als Briefträgerin gearbeitet. Wem würden Sie heute gerne in ein paar persönlichen Zeilen die Meinung schreiben und in den Briefkasten stecken?
Ich freue mich, dass ich als Bundesumweltministerin viele Briefe von Kindern und Schulklassen bekomme, die sehr konkrete Fragen zum Umwelt- und Naturschutz, aber auch Lösungsvorschläge haben. Ihnen ausführlicher zu antworten und mich mit ihnen auszutauschen, kommt leider oft zu kurz.